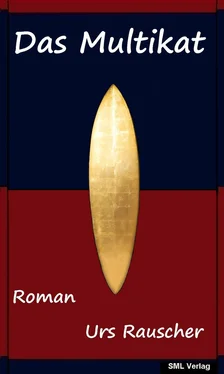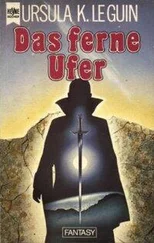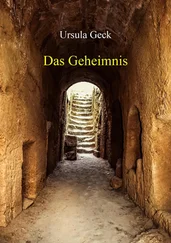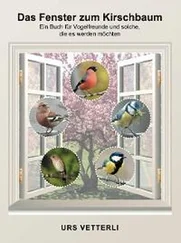Als ich aufwachte, bemerkte ich, dass es bereits dämmerte. Ich war mit dem Kugelschreiber in der Hand eingeschlummert, dieser war aus der erschlaffenden Hand gefallen und in eine Rille zwischen zwei Dielen gerollt. Im Ofen befand sich ein grauer Ascheschnee, von dem nur noch eine Ahnung von Wärme ausging. Ich selbst war furchtbar ausgekühlt, trotz des Vorhangs, in den ich mich auf dem Boden wie eine Leiche gewickelt hatte. Jetzt entrollte ich mich. Dann streckte ich meine steifen Glieder und schüttelte sie aus, um durch die Bewegung wenigstens geringfügig aufgewärmt zu werden.
Der Blick aus dem Fenster verriet mir, dass es ein wolkenloser Tag werden würde, nur dünne Dunstschlieren hingen über dem Berg. Also ging ich vor die Türe, um die ersten Sonnenstrahlen zu erhaschen, doch hier ging ein eisiger Wind, der mich den Rückzug antreten ließ. Ich sah mich nach etwas um, was ich im Ofen verbrennen könnte, hielt nach ein wenig Futter für ein Strohfeuer bis zum Erscheinen der Sonne Ausschau, aber da war nichts mehr. Abermals musste ich nach draußen und mir Holz beschaffen. Doch sowohl das Holz als auch Beil und Stumpf waren nicht mehr an ihrem Platz. Mich beschlich die dumpfe Ahnung, dass Janine sie mitgenommen hatte. Sie hatte sie verschwinden lassen.
Allmählich machten sich Entzugserscheinungen bemerkbar. Der Alkoholgehalt meines Blutes ließ nach. Nach so vielen Wochen ausdauernden Trinkens war mein Organismus für die reibungslosen Fortsetzung seiner alltäglichen Vorgänge vom morgendlichen Schnaps abhängig. Zum ersten Mal machten sich Anzeichen eines Katers bemerkbar. Ich hatte Gliederschmerzen, die nicht von der Kälte kamen, und Kopfschmerzen, die keiner Erkältung entstammten. Ein flauer Magen meldete sich mit Aufstoßen, während eine Grundübelkeit mich ständig zum Würgen reizte. Auch literweise furchtbar kaltes Wasser aus dem Gebirgsbach und eine ausgiebige Entgiftung meiner Blase taten diesem Zustand keinen Abbruch. In meinem Koffer kramte ich nach Medikamenten, doch nach ergebnisloser Suche kam mir, dass man mir meinen Medikamentenkoffer am Flughafen abgenommen hatte.
In diesem Zustand der Zermarterung beschloss ich, in der Hütte auf die Sonne zu warten, geschlungen in diesen dünnen Fetzen, den die Bhutaniker als geeignet für den Dienst an der Vorhangstange hielten. Allmählich entsann ich mich der Vorgänge vom Vorabend. Ich musste unaussprechbar betrunken gewesen sein. Nichtsdestotrotz hatte ich etwas geschrieben und ich meinte mich sogar daran erinnern zu können, dass ich dabei sehr zufrieden mit mir gewesen war. Heldenhaft ausdauernd hatte ich den Kugelschreiber geschwungen, bis ich vor Müdigkeit weggekippt war. Die Erinnerung weckte mein Interesse an dem Produkt meiner Selbstüberwindung. Ich hatte etwas zu Papier gebracht! Stolz erfüllte mich und ich stürzte voller Vorfreude zum Papierhaufen, der über den Schreibtisch verteilt war.
Das erste Stück Text, das ich in Händen hielt, war nicht zu verstehen. Wörter reihten sich aneinander, die aus syntaktischen und logischen Gesichtspunkten nicht nebeneinander gehörten. Sämtliche Sätze, wenn sie denn welche sein sollten, ergaben keinen Sinn, dazu war die Schrift so ungelenk und krakelig, dass ich zunächst der Überzeugung war, jemand anderes müsse diesen Mist dorthin geschmiert haben. Dann aber sagte ich mir, dass diese Zeilen ganz zum Ende hin, im Zustand größter Erschöpfung und Schlaftrunkenheit entstanden sein mussten. Also griff ich nach einem weiteren Blatt, doch mit diesem verhielt es sich genauso wie mit dem ersten. Je mehr Seiten ich mir durchsah, desto blasser wurde ich. Immer schneller griff ich nach den Blättern und immer schneller ließ ich sie fallen, weil ich feststellte, dass sie nichts als ein einziges großes Panorama der Sinnlosigkeit entwarfen. Das Entsetzen über meine Worte führte dazu, dass ich schließlich den gesamten Haufen vom Tisch wischte, aufhob und in den Ofen steckte. Erst jetzt ging mir auf, wie besoffen ich gewesen war, wie besoffen ich all die Tage, all die Abende gewesen war. Ich war ein Schriftsteller und hatte einen solchen Unsinn produziert. Beschämend. Das konnte ich mir selbst nicht durchgehen lassen. Aus diesem Grund musste ich mich nicht zum Schwur durchringen, dass ich von nun an keinen Tropfen Alkohol mehr zu mir nehmen würde. Nein, ich leistete ihn mit dem Gefühl der Erlösung. Jetzt musste nur noch Janine von ihrem Irrweg abgebracht werden. Auch wenn dies bisher nicht angewandte Methoden erforderte. Unmoralische Methoden.
Und dann war da Kim. Es fiel mir schwer, mich zu erinnern, wann ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. War es am Vorabend gewesen? Hatte er sich zu uns gesellt? Oder war dieses Bild, das ich von ihm hatte, auf dem er sich neben uns im Schneidersitz niederlässt und Reisschnaps kippt wie ein Alkoholiker Klosterfrau Melissengeist, nur eine Art Blaupause, die ich auf jeden Abend legen konnte, ohne ihn maßgeblich zu verfälschen? Es konnte auch durchaus sein, dass er seit zwei Wochen nicht mehr mit uns gesprochen hatte. Ich verwarf den Gedanken; all dies spielte keine Rolle. In meinem Kopf schlug ein winziger tibetischer Mönch wie wild mit einem Hammer gegen die Schädeldecke wie gegen einen Gong, so als wollte er mich daran erinnern, dass ich ein ernsthaftes Wort mit Kim sprechen musste.
Nach circa einer halben Stunde setzte ich mich, noch immer in den Vorhang eingewickelt, vor meine Hütte und ließ die Sonne mein Gesicht kitzeln. Ich döste sogar noch einmal ein, bis mich schließlich die Warmluft weckte, die sich unter dem Stoff angestaut hatte. Es kostete mich einige Überwindung, mich zu duschen, wie jeden Morgen. Ich konnte mich einfach nicht an das zwei Grad warme Wasser gewöhnen, das meine Haut wie fallende Eiszapfen zu durchbohren schien. Immerhin war ich danach hellwach und tatendurstig.
Ich ging hinunter in den Ort und ließ mir im Café ein Frühstück zubereiten. Weng, der junge Kellner, begrüßte mich routiniert und stellte ein gefülltes Schnapsglas vor mich hin, noch bevor er einen Saft und einen Becher vergorene Yakmilch brachte. Ich widerstand der Versuchung und schob den Schnaps von mir weg. Als Weng wiederkam, sah er mich mit schief gelegtem Haupt und ungläubigen Augen an, und fragte mich, ob es mir gut gehe. Ich sagte, alles sei gut, aber heute wolle ich keinen Schnaps. Mit missfälligem Grunzen nahm er das Glas und stürzte es.
Die Yakmilch war ohne vorherigen Schnapskonsum kaum herunterzubringen, ich zwang sie am Schluckmuskel vorbei und goss sie mit Saft die Speiseröhre hinab. Dann aß ich mein Porridge und bezahlte. Als ich schon auf der Straße stand, besann ich mich und ging noch einmal zurück zu Weng. Auf meine Frage, ob er Janine gesehen habe, sagte er, sie sei kurz nach dem morgendlichen Öffnen aufgekreuzt und habe zwei Schnaps getrunken. Dann sei sie mit seltsam abgedrehtem Blick hinausgegangen, habe eine Weile auf der Straße gestanden und sei in Zeitlupe auf jenem Weg davongegangen. Weng zeigte in Richtung ihrer Wohnung.
Die irrlichternde Janine. In mir wogte der Kampf zwischen dem Alkoholteufel und dem Abstinenzengel. Der Engel gewann durch unwiderstehliche Versprechungen: Alles würde gut werden. Ich würde mein Buch schreiben, meine Million einkassieren, Beate wiedersehen. Und zur Feier all dessen würde ich einen Bourbon trinken und einen Eid ablegen, dass nie wieder ein Tropfen Reisschnaps meine Lippen passieren würde.
Ich war der ungeliebte Missionar, der einem Alkoholiker den Schluckdämon austreibt und ihm die heilige Schrift der Entsagung bringt. Und so konnte ich mir gut vorstellen, dass ich, ähnlich einem jesuitischen Bekehrer bei den gottlosen Buddhamenschen der tibetischen Hochebene, bei Janine auf Ohren stoßen würde, die mit dem Schmalz des Glaubenseifers versiegelt waren. Ähnlich wie solch ein waghalsiger Diener des Herrn lief ich Gefahr, einen Märtyrertod zu sterben. Zumindest würde sie ihrerseits versuchen, ihren Heidenkult um das Feuerwasser einem abgefallenen Sünder wieder näher zu bringen.
Читать дальше