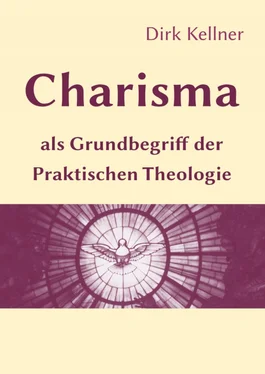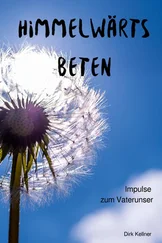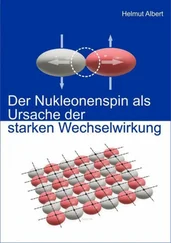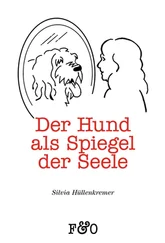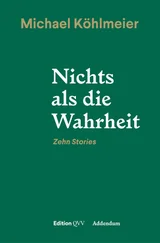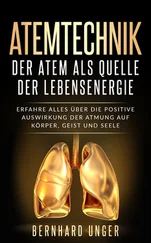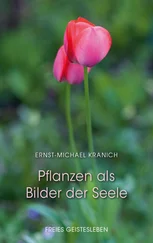2. Der Begriff «Charisma» wird von Möller stets gegen das enthusiastische Missverständnis abgegrenzt, das sich bereits in der korinthischen Begeisterung für die Pneumatika zeigte und durch Max Webers Definition als «außeralltäglich […] geltende Qualität einer Persönlichkeit»[869] nicht nur den allgemeinen Sprachgebrauch, sondern auch die theologische Verwendung des Begriffs geprägt hat (→ 2.2.4.2). Die «Spitze» des paulinischen Charismabegriffs weist nach Möller gerade «in die Niederungen des Alltäglichen und Unscheinbaren».[870] Charisma müsse nicht in außergewöhnlichen Phänomenen erstrebt und erzwungen, sondern könne im täglichen Leben entdeckt werden. Dem entspricht, dass die von Möller genannten Beispiele vor allem dem beruflichen Lebensbereich entstammen, während die in den neutestamentlichen Charismenlisten erwähnten Charismen kaum Erwähnung finden: Der Jurist und der Lehrer bringen ihre beruflichen Kompetenzen ein;[871] die Friseurin, der Kneipenwirt und der Taxifahrer verwirklichen im Zuhören-Können das Charisma der Seelsorge in alltäglicher Gestalt.[872]
Möller nimmt damit die Intention Käsemanns auf, nach der nicht nur die individuellen Fähigkeiten, sondern auch der soziale und berufliche Stand und somit die «gesamte Wirklichkeit des Lebens» zum Charisma werden kann.[873] Gegen diese Ausweitung des Charismabegriffs ins Ethische und Soziale ist in der modernen Exegese berechtigter Widerspruch erhoben worden. So urteilt Ulrich Brockhaus, dass Käsemann «weit über die von Paulus gebahnten Pfade und gezogenen Grenzen hinaus geht» und damit die paulinische Charismenlehre «sprengt»:[874]
«Für Paulus kann eben nicht alles zum Charisma werden, sondern nur das, was in der Gemeinde erkennbar als Gabe des Geistes wirksam ist. Paulus ist dabei keineswegs eng; seine Tendenz geht auf eine Erweiterung der Charismenliste, aber er erweitert sie um Tätigkeiten, Begabungen, Funktionen, nicht um sexuelle, soziale oder religiöse Gegebenheiten.»[875]
Möller hat der «Ethisierung des Charismas» selbst widersprochen und die pneumatische Dimension betont. Charismen sind eben «ihrem Wesen nach […] nicht einfach natürliche Begabungen», sondern Gaben des «Geistes von oben», der «als eine Macht […] senkrecht von oben einbricht».[876] Deshalb betont er stets die Notwendigkeit der Verwandlung von Fähigkeiten in Gaben. Erst wenn in der Kraft des Geistes die natürlichen Begabungen in den Dienst Gottes und des Nächsten gestellt werden, können sie zu Gaben werden. Dieser vom Geist bewirkte Verwandlungsprozess wird von Möller nicht weiter theologisch erläutert. Es scheint so, als ob sich das Geistwirken auf die Bewusstseinsänderung beschränkt. Rechnet aber Paulus nicht auch damit, dass der Geist neue Gaben schenkt, ohne auf die Vorgaben einer natürlichen Basis festgelegt zu sein? So sehr Möllers «Leidenschaft für den Alltag» zu würdigen ist, muss doch kritisch geprüft werden, ob sein Charismakonzept der bleibenden Wirkursprünglichkeit des Geistes genügend Rechnung trägt. Damit ist eine wichtige Frage für die biblisch-theologische Rekonstruktion der Charismenlehre aufgeworfen: Wie kann die natürliche Begabung, die berufliche Kompetenz und der soziale Stand so in Beziehung zum Charisma gesetzt werden, dass der Geist derjenige bleibt, der nach 1Kor 12,11 «alles wirkt […] und einem jeden zuteilt, wie er will» (→ 5.4)?
3.7 Resümee: Die oikodomische Rezeption der Charismenlehre – Folgerungen für die weitere Untersuchung
Die Rezeption der Charismenlehre in der Oikodomik lässt sich (1.) in konzeptionsgeschichtlicher Hinsicht zusammenfassen und (2.) in Bezug auf die wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkte und offenen Fragen der Diskussion darstellen. Dabei wird nicht nur die oikodomische Relevanz der Charismenlehre deutlich, sondern auch der Problemhorizont für die biblisch-theologische Rekonstruktion der Charismenlehre nachgezeichnet.
1. Alle in diesem Kapitel dargestellten Konzeptionen des Gemeindeaufbaus rezipieren die Charismenlehre, bringen sie aber in je unterschiedlicher Akzentuierung und Funktion in den oikodomischen Begründungszusammenhang ein:
a. Im missionarisch-ökumenischen Ansatz wird die Charismenlehre in einer amtskritischen Zuspitzung gegen die «Betreuungsstruktur» der Volkskirche gewandt und zur Begründung des weltverantwortlichen Dienstes der Laien herangezogen. Darüber hinaus kann vor allem Werner Krusche durch die Orientierung am paulinischen Leitbild ein relatives Eigenrecht der Sammlung und gegenseitigen Erbauung für die Gemeinde zurückgewinnen und in seiner theologischen Legitimität behaupten.
b. Der volkskirchlich-konziliare Ansatz betont das demokratische und partizipatorische Moment der Charismenlehre und sieht im paulinischen Verständnis der charismatischen Gemeinde ein Paradigma kommunikativer Gemeindepraxis, in der sich der herrschaftsfreie Diskurs potentiell aller Gemeindemitglieder präfiguriert (Christof Bäumler), bzw. ein Modell von Koinonia als heilender Partizipation am Leib Christi (Ralph Kunz) gegeben ist.
c. Im missionarisch-evangelistischen Ansatz konzentriert sich die oikodomische Funktion der Charismenlehre auf die theologische Qualifizierung des Dienstes der Mitarbeitenden. Alle Aufgaben und Arbeitsbereiche der Gemeinde werden an ein befähigendes Wirken des Geistes gebunden. Gemeindeaufbau und Charismatik koinzidieren (Fritz und Christian A. Schwarz). Zugleich wird – wie in der missionarisch-ökumenischen Konzeption – die Charismenlehre in Beziehung zum Missionsbefehl gebracht. Der Fokus liegt aber nicht auf dem Laiendienst für Frieden und Gerechtigkeit, sondern auf Gemeindewachstum durch Evangelisation und Integration in die Gemeinde. «Gabenorientierung» wird zum «vital sign» (C. Peter Wagner) bzw. «Qualitätsmerkmal» (Christian A. Schwarz) wachsender Gemeinden.
d. Bei Christian Möllers Versuch der Überwindung falscher oikodomischer Alternativen ist die paulinische Charismenlehre ein inspirierendes Beispiel für eine von der Agape bestimmte, im Gemeindeaufbau anzustrebende Grundeinstellung. Sie lenkt den Blick von den Defiziten und von den zur Behebung der Defizite entworfenen Programmen auf den verheißenen und bereits geschenkten Reichtum an Gaben.
2. a. In der oikodomischen Diskussion hat sich bisher kein theologisch geklärter und konsensfähiger Charismabegriff etablieren können. Werner Krusche und Christof Bäumler verwenden «Charisma» weitgehend synonym mit «Begabung» oder «Gabe» und verzichten dabei auf eine begriffliche oder inhaltliche Präzisierung. Ralph Kunz entwickelt vor allem im Anschluss an Max Webers Charismakonzept sein Verständnis von Gemeindeaufbau als einer charismatischen Revitalisierungsbewegung, während der theologische Charismabegriff kaum Beachtung findet. Demgegenüber bieten C. Peter Wagner und Christian A. Schwarz Definitionen, die den göttlichen Ursprung ebenso einbeziehen wie die Ausrichtung auf den Aufbau der Gemeinde. Charisma ist nach Schwarz «eine besondere Fähigkeit, die Gott – nach seiner Gnade – jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss»[877]. Christian Möller hält mit seinem Verständnis von Charisma als «Begeisterung für das Alltägliche» am «Geist aus der Höhe als Quelle aller Charismen» fest, weist ihnen aber über den Kontext der Gemeinde hinaus einen Bezugspunkt im Alltag zu.[878] Er konstatiert ein unumkehrbares Gefälle, das «von der Höhe der Gnade in die Tiefe alltäglicher Existenz» reicht.[879] Die unterschiedlichen Akzentsetzungen können einander ergänzen, lassen aber nach einer sie integrierenden theologischen Basis fragen. Diese ist bisher nur unzureichend ausgearbeitet worden und muss als wichtige Aufgabe einer weiterführenden Reflexion markiert werden.[880]
b. Weiterhin bestehen erhebliche Differenzen in der Bestimmung der Kriterien zur Identifikation von Charismen. C. Peter Wagner und Christian A. Schwarz entwerfen in einem additiven Verfahren einen umfangreichen Katalog von 27 bzw. 30 inhaltlich exakt definierbaren Gaben. Sie integrieren diakonische und kerygmatische Gaben, bringen die paulinische Weite des Charismenverständnisses zur Geltung und überwinden dadurch die Fokussierung auf wunderhafte Gaben, wie sie zum Teil im pfingstlerisch-charismatischen Christentum gegeben ist. Allerdings werden sie damit kaum dem exemplarischen Charakter der Charismenlisten gerecht und stehen in der Gefahr, ihr eigenes Verständnis einzelner Gaben in anachronistischer Weise in die neutestamentlichen Belege zu projizieren. Christian Möller weitet den Begriff des Charismas so weit aus, dass er «Gaben» wie Kirchenraum oder Kirchenjahr umfasst. Gleichzeitig betont er, dass jede natürliche Fähigkeit in ein Charisma verwandelt werden kann. Ein vordefinierbarer Katalog von Charismen ist daher nicht zu erstellen, die Charismen sind in ihrer jeweils konkret gegebenen Gestalt zu entdecken. Dabei verbindet sich allerdings das Charisma so eng mit dem sozialen Stand, dass die Wirkursprünglichkeit des Geistes nur noch schwer zu denken ist und für eine über die geschöpfliche Basis hinausführende Befähigung nur wenig Raum zu bleiben scheint. So unterschiedlich die Ansätze sind, weder bei C. Peter Wagner und Christian A. Schwarz noch bei Christian Möller wird das implizite Zurücktreten der dynamisch-aktualen Qualität des Charismas problematisiert. In beiden Fällen zeigt sich die Tendenz zu einem habituellen Charismenverständnis. Charisma wird zu einer Begabung, die dem Menschen einmalig verliehen wurde – sei es als Gabe des Geistes bei der Wiedergeburt (Wagner, Schwarz), sei es durch einen Prozess der Umwandlung natürlicher Begabung (Möller) – und nun als jederzeit aktualisierbares Potential in seiner Verfügung steht. Das Geistwirken wird auf einen initialen Akt der Begabung beschränkt.
Читать дальше