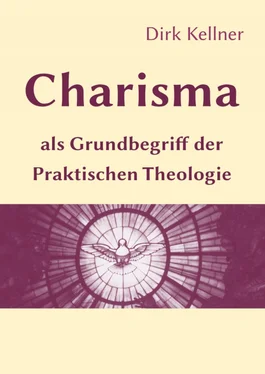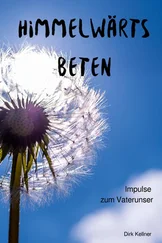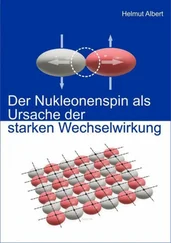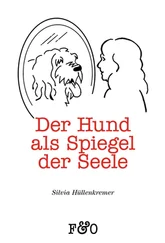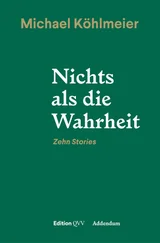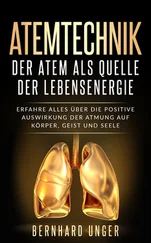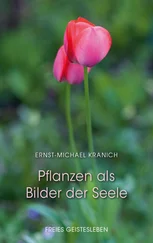Trotz einiger ungeklärter Fragen[797] wäre die Anwendung des funktionalen Paradigmas auf die charismatische Dimension von Gemeinde dennoch weiterführend. Sie wurde von Schwarz nicht explizit vollzogen, läge aber in der Konsequenz seines Ansatzes und würde zugleich der von Leonardo Boff aufgestellten und von Werner Krusche rezipierten Bestimmung des Charismas zum «Organisationsprinzip» und zur «strukturierende[n] Struktur» der Kirche entsprechen:[798] Das Charisma ist unverfügbar, denn die Kirche kann sich die Gaben des Geistes nicht selbst schenken. Sie kann und soll aber ihre institutionellen und organisatorischen Elemente so gestalten, dass den Charismen der größtmögliche Raum zur Entfaltung gegeben wird.[799]
4. Charismatische Gemeinde ereignet sich nach der «Theologie des Gemeindeaufbaus» nicht in der Institution, sondern ausschließlich in der Ekklesia. In der überschaubaren geistlichen Zelle als der grundlegenden Sozialgestalt von Ekklesia werden die Charismen im gemeinsamen Hören, Beten, Feiern und Arbeiten entdeckt und praktiziert. Diese «ganzheitlichen christlichen Gemeinschaften» sind der «Übungsplatz für geistliche Gaben».[800] In ähnlicher Weise hatte schon Werner Krusche die «kleinen Gemeinschaften kommunikativen Lebens» als den Ort bezeichnet, an dem Gemeinde Jesu Christi als charismatische Gemeinschaft Wirklichkeit wird.[801] Mit Krusche stimmen die Autoren auch darin überein, dass das Wirken der Charismen nicht auf den Binnenraum der Ekklesia beschränkt werden darf, sondern dass die Glaubenden durch die Charismen zum missionarischen und diakonischen Wirken in Kirche und Welt berufen sind.[802] Dem Separatismus und der Isolation einer ekklesiola wird gerade durch die charismatische Berufung entgegengesteuert.
Kritisch zu fragen ist allerdings, ob mit der Gleichsetzung von charismatischer Gemeinde und Ekklesia nicht die faktische Beschränkung der Charismen auf die aktiven und kontinuierlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einhergeht. Müsste neben die Kleingruppen nicht gleichberechtigt die gottesdienstliche Gemeinde treten, wenn sie nach paulinischem Zeugnis der primäre Ort ist, an dem der Geist die Gaben schenkt (1Kor 14,26)? Dann wäre der Gottesdienst mehr als nur «eine Chance, religiös interessierte Menschen das Evangelium zu verkündigen»[803]. Der Gottesdienst wäre als Ort der Epiphanie und Manifestation des Geistes wahrzunehmen, der die Ekklesia davor bewahrt, das Wirken des Geistes nur in ihren eigenen Reihen zu suchen, und die Institution mit dem an sie gestellten Anspruch behaftet, dem Ereigniswerden von charismatischer Gemeinde zu dienen. Gerade im Gottesdienst könnte sich die charismatische Gemeinde als «kritisches Prinzip» erweisen, das die kirchliche Institution gerade nicht in ihrem Status quo verfestigt, sondern zur «Reformation der Strukturen» drängt.
5. Der Charismenlehre kommt bei C. Peter Wagner, Fritz und Christian A. Schwarz eine hohe oikodomische Relevanz zu. Sie spiegelt sich in der Aussage: «Gemeindeaufbau ist Charismatik, nichts als Charismatik.»[804] Denn «ohne den Heiligen Geist und seine Gaben kann kein Gemeindeaufbau gedeihen»[805]. Eine theologische Begründung dieses Postulats ist allerdings nur schwer auszumachen. Es bleibt im Wesentlichen bei pragmatischen oder empirischen Argumentationsmustern: Die theologische Orientierung an den Charismen verhindere eine Überforderung der Mitarbeitenden[806], weise den Weg zur Überwindung der Pastorenkirche[807] und habe sich als wichtiges gemeindliches Qualitätsmerkmal erwiesen.[808] Diese Bedeutung und Funktion der Charismenlehre ist nicht zu bestreiten, dennoch sieht sich die weitere Untersuchung vor die Herausforderung gestellt, ihre oikodomische Relevanz umfassend theologisch zu fundieren.
3.6 Christian Möller: Gemeindeaufbau im Prozess gegenseitiger Mitteilung von Gaben
Die bisher dargestellten Entwürfe lassen sich entweder einem missionarisch-ökumenischen (Krusche), einem volkskirchlich-konziliaren (Bäumler, Kunz) oder einem missionarisch-evangelistischen Gemeindeaufbau-Ansatz (Wagner, Schwarz) zurechnen. Christian Möllers Impulse und Anregungen liegen bewusst quer zu den bestehenden Positionen und wollen die verhängnisvolle Alternative gegensätzlicher Konzeptionen durch ein Verständnis von «Gottesdienst als Gemeindeaufbau» bzw. durch Konzentration auf «Gottes Dienst» als der Mitte des Gemeindeaufbaus überwinden. Der Entdeckung und Wahrnehmung des Reichtums der Gemeinde, vor allem ihres Reichtums an Gaben, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
3.6.1 Von «Gottesdienst als Gemeindeaufbau» zu «Gottes Dienst im Gemeindeaufbau»
In Anknüpfung an Theorie und Praxis des Gemeindeaufbaus innerhalb der Bekennenden Kirche sieht Möller im Gottesdienst «Ursprung, Mitte und Ziel alles Gemeindeaufbaus»[809]. Im Gottesdienst verbinden sich einladende Weite und konzentrierte Mitte.[810] Die lähmende und unechte Alternative von volkskirchlichen und missionarischen Konzeptionen lasse sich im Sinne des dritten Artikels der Barmer Theologischen Erklärung überwinden in einem «auf die Mitte hin konzentrierte[n] Gemeindeaufbau», in dessen Zentrum der «gegenwärtig in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist handelnde Jesus Christus steht, der das Haupt ist, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt wird».[811] Das Vertrauen auf die Selbstwirksamkeit des Wortes und das Ernstnehmen von Gottes objektivem Handeln in der Taufe sind daher stets wiederkehrende Motive von Möllers Veröffentlichungen und kritischen Stellungnahmen zur oikodomischen Diskussion. Es geht ihm nicht um Aktionspläne und Strategien, nicht um Programme und Konzepte, sondern um eine von der Liebe bestimmte geistliche Grundhaltung, mit der Gemeinde «erglaubt» und Gemeindeaufbau im Vertrauen auf Gottes Wirken «erbeten», «erhofft» und «erwartet» werden kann. Denn die Liebe erbaue die Gemeinde gerade dadurch, dass sie ihren Reichtum – gerade auch den Reichtum an Charismen – glaubend voraussetzt.[812] Gemeindeaufbau könne daher nur geschehen als «Gemeindeaufbau im Kraftfeld der Liebe».[813]
Sein zentrales theologisches Anliegen sieht Möller «knapp und präzise» in den wenigen Worten zusammengefasst: «dass Gott zum Zuge kommt».[814] Seit dem zweiten Band der «Lehre vom Gemeindeaufbau» übernimmt er Luthers Schreibweise «Gottes Dienst». Es gehe nämlich letztlich nicht um den «Gottesdienst», der in einem «kurzschlüssige[n] Biblizismus»[815] normativ-deduktionistisch zur Mitte der Gemeinde erklärt wird, sondern um «Gottes Dienst in der Kraft seines Geistes»[816]. Entscheidend sei «Gottes Tätigkeit […], in die sich menschliche Tätigkeit einzufügen hat»[817]. Zusammenfassend schreibt Möller:
«Es geht mir jedoch um ein ganzheitliches Verständnis von Gottesdienst, das Sonntag und Alltag umfaßt. Dabei habe ich nicht in erster Linie ein Tun von Menschen im Blick, sondern […] Gottes Dienst, der immer wieder darauf wartet, daß Menschen ihm sonntäglich wie alltäglich entsprechen, um dadurch zur Gemeinde erbaut zu werden. Dieser die Menschen immer wieder neu durch Wort und Sakrament rufende wie immer wieder neu durch die Sakramente von Taufe und Abendmahl einladende Gottes Dienst ist der eigentliche und wahre Baumeister, der in dieser Lehre vom Gemeindeaufbau in den Blick kommen soll.»[818] «Mit Gottes Dienst meine ich nicht schon ein Tun von Menschen, sondern dasjenige, was allem menschlichen Tun vorausliegt und doch immer wieder darauf wartet, daß Menschen ihm entsprechen, und zwar weniger durch ein Tun als durch ein Empfangen, Anbeten, Sich-Beschenken lassen. Daraus folgt ein ganzheitliches Gottesdienstverständnis, das den sonntäglichen und den alltäglichen Gottesdienst wie Systole und Diastole eines Herzschlags zusammen sieht.»[819]
Die größte Gefahr des Gemeindeaufbaus sei, dass er «in die Hände des homo faber»[820] fällt und sich in einen geistlosen Aktionismus verkehrt. An die Stelle des Vertrauens auf Gottes Wirken treten dann Programme und Strategien, die in einem pragmatischen Machbarkeitswahn Gemeinde aus eigener Vernunft und Kraft bauen wollen. Demgegenüber versucht Möller durch eine Orientierung an der «biblischen Denk- und Sprachform der Oikodome»[821] ein Verständnis von Gemeindeaufbau als einem «Baugeschehen» zu entwickeln, das allem menschlichen Handeln vorausliegt, weil Christus selbst es durch sein Wort ins Werk setzt - «mit uns, ohne uns, ja, sogar gegen uns».[822]
Читать дальше