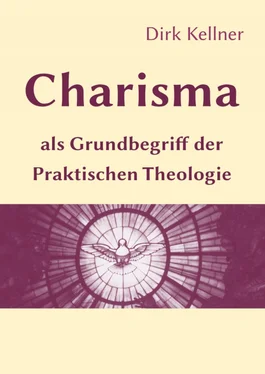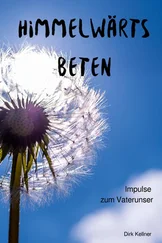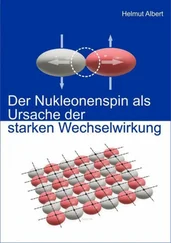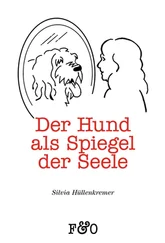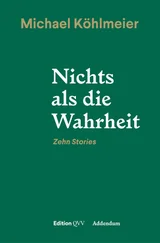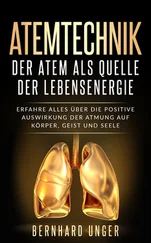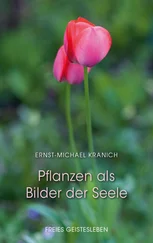Anfragen ergeben sich allerdings hinsichtlich der Tendenz zu einem statischen, habituellen Charismenverständnis. Wie Wagner widerspricht auch Schwarz der Identifizierung von Charisma und natürlicher Begabung, setzt aber beides in Analogie:[781] Charismen sind spezielle Fähigkeiten. Sie sind nicht von Natur aus vorhanden und werden erst durch den Geist geschenkt, dennoch stehen sie dem begabten Menschen zur freien Verfügung und können jederzeit geplant und gezielt eingesetzt werden. Die einmal empfangenen Gaben werden zu einem «lebenslangen Besitz»[782] des Menschen, sie sind selbst dann vorhanden, wenn sie verborgen und ungenutzt bleiben. Mit der einmaligen Begabung durch den Geist liegen Möglichkeiten und Grenzen der Mitarbeit am Leib Christi fest. Nun berichtet aber bereits Wagner, dass er selbst zuerst nur die Gabe der Lehre, die Gabe der Erkenntnis und die Gabe des Missionars hatte,[783] er aber dann von Gott die Gabe der Heilung und später die des Apostels empfangen habe.[784] Wagner folgert: «So sehr wir sehen müssen, welche Kombination von Gaben uns Gott bereits gegeben hat, so müssen wir gleichzeitig offen sein für neue Gaben, die Gott uns in Zukunft schenken möchte.»[785] In ähnlicher Weise gehen Fritz und Christian A. Schwarz in der «Theologie des Gemeindeaufbaus» davon aus, dass der Gemeindeaufbau neue Gaben «provoziert».[786] In der «Praxis des Gemeindeaufbau» warnt Christian A. Schwarz ausdrücklich davor, die einmal erkannten Gaben «als statische[n] Besitz» zu verstehen, und ermahnt, «offen für neue Gaben» zu sein.[787] Es muss allerdings kritisch gefragt werden, ob diese Akzente in der Gesamtkonzeption genügend berücksichtigt werden. Sie relativieren weder den Anspruch des Gabentests, mit «sehr großer Wahrscheinlichkeit» die eigenen geistlichen Gaben zu ermitteln,[788] noch die Forderung, Aufgaben, die nicht der eigenen Begabung entsprechen, möglichst rasch preiszugeben. Weiterhin droht durch die Analogie von menschlicher Begabung und Charisma das Geistwirken auf den einmaligen Akt des Beschenkens reduziert und dadurch marginalisiert zu werden. Das Charisma würde zum eigenen «Können» und wäre sakramentalistisch missverstanden, als hätte der Mensch durch die Geistbegabung eine übernatürliche, ihn dauerhafte befähigende Potenz in sich, deren Aktualisierung in seine Möglichkeiten gestellt ist.[789]
Es wird im weiteren Verlauf der Untersuchung zu zeigen sein, dass die paulinischen Belege den Charismabegriff dynamisch-aktual akzentuieren und das verbreitete statisch-habituelle Verständnis in Frage stellen (→ 5.3). Charisma ist demnach kein statischer Besitz, keine habituelle Potenz vordefinierbaren Gehalts, sondern die in Treue und Freiheit vom Geist geschenkte Befähigung zu einem konkreten Dienst – eine Befähigung, die nicht gesichert, sondern immer wieder neu im Vertrauen auf die Verheißung Gottes empfangen werden kann. Neben dem Entdecken der bereits geschenkten Befähigungen wird dem vertrauensvoll bittenden Bemühen um Wieder- und Neuzuteilung von Charismen mehr Gewicht beizumessen sein, als dies bei Schwarz und Wagner geschehen ist (vgl. 1Kor 12,31a; 14,1.14). Es muss deutlich werden, dass der Heilige Geist sich in der Zuteilung der Charismen nicht an vordefinierte Kataloge richtet, sondern sie «einem jeden gibt, wie er will» (vgl. 1Kor 12,11). Zugleich ist dem Missverständnis zu wehren, das Charisma verleihe dem Menschen dauerhafte übernatürliche Kräfte. Der Charismatiker ist vielmehr nur ein Werkzeug dessen, der «alles in allem wirkt» (1Kor 12,6). Wagner betont diesen Aspekt ausdrücklich für die Gabe der Heilung. Im Argumentationsduktus von 1Kor 12,1–11 müsste er auf alle Charismen ausgeweitet werden.[790] Ein dynamisch-aktuales Charismenverständnis würde der von Schwarz vorgenommenen Zuordnung des Charismas zum ereignishaften unverfügbaren Aspekt von Kirche entsprechen, also zu «Glaube, Gemeinschaft und Dienst». Denn diese Elemente sind «nicht einfach vorauszusetzen», sondern müssen «immer wieder neu geschehen».[791] Bei Schwarz hingegen droht das Charisma gegen seine eigene Intention auf die Seite des Statischen und Verfügbaren zu geraten.
2. Die Rolle des Heiligen Geistes im Gemeindeaufbau wurde in den Anfängen der amerikanischen Church-Growth-Bewegung nach McGavrans selbstkritischer Einschätzung nur flüchtig beachtet.[792] Im Vordergrund standen pragmatische Fragen. Wagner und die «Theologie des Gemeindeaufbaus» der Autoren Schwarz haben unabhängig voneinander die pneumatische Dimension des Gemeindeaufbaus nicht nur neu ins Bewusstsein gerufen, sondern zugleich konsequent mit der charismatischen Dimension von Gemeinde verknüpft. Gemeindeaufbau in der Kraft des Geistes ist Gemeindeaufbau in der Kraft seiner Gaben. Die von Christof Bäumler geforderte Verankerung des theologischen Begründungszusammenhangs in der Pneumatologie verliert ihren formalen Charakter.[793] Das Wirken des Geistes muss nicht mehr durch einen abstrakten Freiheitsbegriff formelhaft postuliert, sondern kann theologisch konkretisiert werden als ein befähigendes Wirken, das jedes Gemeindeglied durch die Verleihung von Charismen zu einem bestimmten Dienst in der Gemeinde befähigt und beruft. Dies gilt ebenso für außerordentliche Phänomene wie für das «Alltägliche». Die Rezeption der neutestamentlichen Vielfalt charismatischer Befähigungen durch Wagner und Schwarz verhindern eine Limitierung des Geistwirkens auf das Verbale und Intellektuelle ebenso wie auf das Spektakuläre und Außergewöhnliche. In der aufmerksamen Tat menschlicher Barmherzigkeit (Röm 12,8) manifestiert sich die Wirksamkeit des Geistes ebenso wie in der Heilung eines Kranken oder in der vollmächtigen Predigt des Evangeliums (1Kor 12,8.10). Die pneumatische Dimension verliert durch die Verankerung in der charismatischen ihren doketischen Charakter und wird «verleiblicht».
3. Die Vertreter der Gemeindewachstumsbewegungen stehen immer wieder vor dem offenen Problem der «Machbarkeit» des Gemeindeaufbaus. Wie verhält sich im Gemeindeaufbau menschliches Handeln und göttliches Wirken zueinander? Durch das funktionale Paradigma versucht Christian A. Schwarz das Institutionelle von dem Ereignishaften zu unterscheiden und so zuzuordnen, dass dadurch dem menschlichen Planen und Organisieren im Gemeindeaufbau zugleich Notwendigkeit und Grenze zugewiesen werden. Das Institutionelle ist «machbar», das Ereignishafte «unverfügbar». Das Ereigniswerden des Unverfügbaren kann durch das Institutionelle ermöglicht, aber auch gehindert werden. Diese hilfreiche und weiterführende Zuordnung überwindet die problematische Polarität von Kirche und Ekklesia, die die «Theologie des Gemeindeaufbaus» kennzeichnete. Sie droht jedoch durch die biokybernetische Argumentation und ihre Legitimation mittels einer unreflektierten analogia entis eher verdunkelt zu werden,[794] wenn Schwarz von «Wachstumsautomatismen» spricht und damit gegen seine Intention ein quasi-lineares Kausalverhältnis von verfügbarem qualitativen Wachstum und unverfügbarem quantitativen Wachstum aufbaut.[795] Demgegenüber kann auf Karl Barth verwiesen werden. Er hat den Zusammenhang von intensivem (qualitativem) und extensivem (quantitativem) Wachstum der Gemeinde nicht bestritten, aber relativiert und jedem menschlichen Kalkül entzogen.
«Es ist nicht an dem, daß ihr intensives Zunehmen ein extensives zwangsläufig nach sich zöge. Man wird sich also nicht etwa um eine vertikale Erneuerung der Kirche bemühen können, um ihr von daher eine größere Ausdehnung in der Horizontale, größeren Zulauf zu verschaffen. Irgendeinmal und irgendwie wird sie, wo sie in der Erneuerung in der Vertikale wirklich begriffen ist, wohl auch jenes Aufstehen neuer Christen und also jenen Zuwachs ihres Bestandes erleben, aber vielleicht zu einer ganz anderen Zeit und in ganz anderem Stil und Umfang, als sie es vermutet hatte.»[796]
Читать дальше