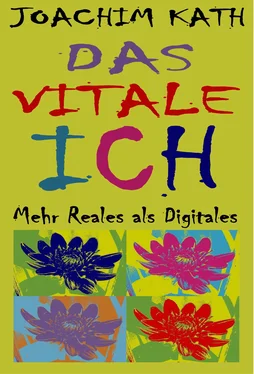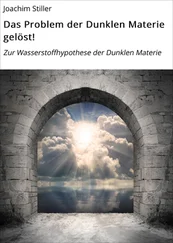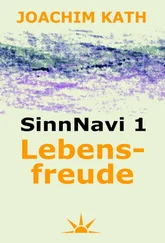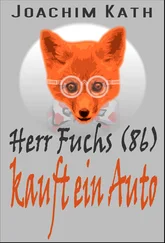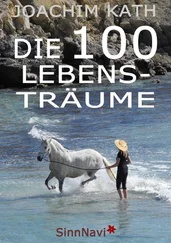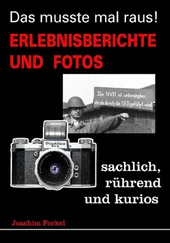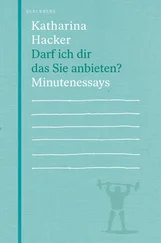Um mehr Profil gegenüber der gesellschaftlichen Selbstmarginalisierung des „Anything goes“ zu gewinnen, ziehen die Institutionen, egal ob sie nun politische Parteien, Universitäten, Unternehmen, Kirchen oder Gewerkschaften sind, den inhaltlichen Substanzverlust zunehmend vor. Statt Vertrauen und Orientierung zu bieten, verlieren sie ihre Problemlösungskompetenz, aus der sie eigentlich ihre Existenzberechtigung ableiten. Institutionen, deren Versprechen nicht mehr geglaubt werden, sind besonders überflüssig. Ihr Handeln jenseits selbst aufgestellter übergeordneter Wertmaßstäbe scheint zur Normalität verkümmert zu sein. Populismus durch rhetorische Demagogie, Opportunismus (von lat. opportunitas = Vorteil, Bequemlichkeit) ,überhaupt die prinzipienlosen Änderungen von Meinungen und Einstellungen, sind augenfällig auf dem Vormarsch.
Der Bedarf an Wissen und Selbstreflexion wächst in sämtlichen Lebensbereichen. Die Mehrheit der Menschen strebt heute eine Wissens- und Bewusstseins-Elite an und zieht sie dem Status der Geldelite vor. Wir brauchen stärker als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit ein Gegengewicht für unsere vielfältigen Zweifel. In Goethes „Maximen und Reflexionen“ heißt es: „Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß; mit dem Wissen wächst der Zweifel.“ Sicherlich vermehren sich die offenen Fragen, wenn man in einen Wissensbereich tiefer eindringt. Doch auf sich allein gestellt, der Verzweiflung zu entkommen, erscheint ohne Wissen erst recht problematisch. Die der Angst und Verzweiflung entgegengesetzte Grundempfindung ist die Hoffnung. Nur Erfahrung, also die Methode der Empirie, sich auf Erfahrung zu stützen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, bringt am Ende begründete Hoffnung.
„Wer selbst sein Meister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan.“ Ein wunderbarer Satz aus dem Gedicht „An sich“ des Barockdichters Paul Fleming. Auch wenn ich das Barockzeitalter, also das 17. Jahrhundert, mit seiner teilweise schwülstigen Kunst nicht uneingeschränkt schätze, weil mir das Streben der Kirche und Aristokratie nach übertriebener Repräsentation aus psychologischer Sicht einigermaßen suspekt ist, glaube ich, wir können hier trotzdem einiges lernen. Einerseits selbst bestimmt und bewusst zu agieren und sich andererseits auch selbst zu zügeln und zurück zu halten, diese Balance ist nicht ganz einfach, aber erstrebenswert.
Das Leben ist viel schwieriger geworden
Noch vor gar nicht so langer Zeit war die vorherrschende Meinung, die Globalisierung und die Revolution der Kommunikationstechnologien würden uns zusammenbringen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen nutzen ihre Freiheit und die Technik um neue Gruppen und Kulturzonen zu bilden. Sie schaffen zahlreiche Lifestyle-Segmente mit sichtbaren und unsichtbaren Barrieren, zu denen nur gleich Gesinnte Zugang haben. Von immer mehr Leuten werden die Vorteile der Moderne genutzt, Do-it-yourself-Stämme zu bilden, die nicht selten recht rigide Vorstellungen haben. Was im Mikrokosmos auseinander driftet, wird sich im Makrokosmos nicht finden. So ist es auch: Transnationale Träume wie ein vereintes Europa oder eine ökonomische und ökologische Annäherung Europas an die Vereinigten Staaten rücken derzeit ebenso in weite Ferne wie die bestenfalls vordergründige Annäherung der Weltreligionen. Machen wir uns nichts vor, Großprojekte sind doch heute in Demokratien praktisch gar nicht mehr durchzubringen. Das spricht nicht gegen unsere Staatsform, weil sie dem Einzelnen erst Freiheit gewährt, aber es zeigt auch die verzweifelten Versuche der Rückbesinnung auf das persönlich Überschaubare in einer Welt, die ansonsten alles andere als überschaubar ist.
Der Begriff „Spiritualismus“ wird heute, wie man als aufmerksamer Zuhörer feststellen kann, gerade von jungen Menschen bei ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens sehr viel verwendet. Er kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Seele und Geist. Einmal davon abgesehen, dass der Sinn des Lebens das Leben selbst ist, ist Spiritualismus die im Gegensatz zum Materialismus stehende Auffassung in der Philosophie, dass dem Geistigen und nicht dem Körperlichen die höchste Realität zukommt. Es fällt nicht schwer, dieser Auffassung zuzustimmen. Doch kann schon gar nicht übersehen werden, dass das Mehrheitsverhalten in krassem Gegensatz zu dieser Position steht. In der Mathematik ist ein Körper eine Menge von Elementen, mit der nach bestimmten Regeln gerechnet werden kann. Auch unser eigener Körper besteht aus vielen Elementen, nicht nur den Urstoffen Wasser und Luft der antiken griechischen Philosophie, deren Anteil im Körper beachtlich hoch ist. Vielleicht hat der übertriebene Körperkult, der heute überall zu beobachten ist, den Geist etwas ins Hintertreffen gedrängt. Jedenfalls kann oft nicht mehr damit gerechnet werden, für komplexe Probleme selbst seitens unserer Eliten so ohne Weiteres nachhaltige Lösungen zu finden.
Sich als Einzelner dieser Entwicklung entgegen zu stellen, ist nicht einfach und erfordert ausgeprägten Mut. Nicht nur das, es erfordert neben dem Glauben auch Wissen, wie Sie sich selbst finden. Überhaupt und zumindest ergänzend zu der archaischen Mystik der Religionen und Esoterik, die überall auflebt. Ich finde, auch wenn heute in Demokratien (den wenigen echten Demokratien auf dieser Welt!) bei abweichender Meinung keine Lebensgefahr mehr besteht, verdienen die friedlichen, gewaltfreien Reformer unsere Hochachtung. Ohne Reformen gibt es keinen Fortschritt und deshalb ist unverständlich, wenn mit diesem Begriff heute vielfach das Gegenteil verbunden wird. Nur weil die zuständigen Politiker unfähig sind, positive Veränderungen zu konzipieren und durchzusetzen, sollten wir nicht grundsätzlich eine Neugestaltung unseres Staates bei Steuern, Arbeit, Sozialsystemen, Bürokratieabbau, Umwelt und Bildung ablehnen. Und wir sollten auch im Privatleben offen für eine Neuorientierung sein, wenn wir mit dem Bisherigen unzufrieden sind. Wobei wir allerdings gut daran tun, nicht zu denken, die anderen wären schuld. Der soziale Sachverhalt Schuld hat bei Neurosen eine zentrale Bedeutung und tritt heute weniger als Sünde und mehr als Angst zutage.
Warum heißt dieses Buch „DAS VITALE ICH“?
Gleich aus mehreren Gründen: Das ICH ist, wie schon beschrieben, eine ganz zentrale Funktion der Psyche. Sein Zustand ist überhaupt nicht egal, sondern lebenswichtig für Ihre Vitalität. Wer wollte nicht vital, also voller Lebenskraft sein? Außerdem ist es an sich schon eine Kunst ist, sich im Wandel zu behaupten, sein Leben zu meistern und sein Ich auf dem gewünschten Kurs zu halten. Dazu braucht man Wissen und den Durchblick auf sehr vielen Gebieten. Dann aber auch, weil Leben und Kunst etwas Gegensätzliches sind. Gerade in Hinblick auf einerseits die Natur und andererseits die Technik, die immer mehr unser Leben bestimmt. Während uns das Leben geschenkt wird, ist Kunst in jedem Fall etwas von Menschen Hervorgebrachtes, das sich nicht in seiner Funktion erschöpft. Der Gegensatz der Kunst zur Wissenschaft ist noch gar nicht so alt, sondern wurde erst Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts wirklich deutlich. Kant hat noch die ästhetische Urteilskraft in den Mittelpunkt des Kunstschaffens gestellt, also den Verstand, während später dann die Intuition, also die Eingebung, in Verbindung mit der Natur, das Geniale, mehr in den Vordergrund rückte.
Eins sollte klar sein: Man muss sich vorbereiten. Bildung allein reicht nicht aus. Geld auch nicht. Religion und Esoterik ebenfalls nur bedingt. Wir müssen eigene Lebenskompetenz und Verhaltensökonomie erwerben und die gibt es weder im Supermarkt, noch zum Nulltarif, noch in den diversen Ausbildungsverhältnissen. Und auch nicht kurzfristig. Der Erwerb von Lebenskompetenz ist ein langfristiger, manchmal schwieriger Prozess. Mit dem einzigen Ziel, sich des eigenen Selbst weitgehend bewusst zu werden und die Mitte zu finden. Man kann nur zur Kenntnis nehmen, was man sehen und hören will. Also die Augen aufmachen und die Ohren spitzen! Auch schon mal zwischen den Zeilen lesen! Hellwach und konzentriert sein!
Читать дальше