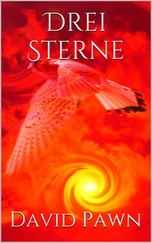Die Stute hat noch kein Schlachtengetümmel erlebt, sie hat gescheut, als die beiden Männer plötzlich laut brüllend aus dem Schilf am Seeufer gesprungen sind. Es war auch sein Fehler, er hat sich ablenken lassen von der Vorfreude darauf, Metú wiederzusehen. Das Pferd ist gestiegen, er ist gefallen und hat versucht, sich mit der Hand abzustützen, dabei hat es ihnen Kan’to, der Meister, der sie eine Kampfkunst ohne Waffen aus einem Land fern im Osten gelehrt hat, als Erstes eingebläut. Wenn man fällt, egal wie, abrollen, nicht aufstützen. Fertig geworden ist er mit den beiden Männern auch mit einer Hand, die Platzwunde in der Augenbraue stammt von dem Sturz, der Schnitt auf seiner Wange von dem Schwert des zweiten Angreifers. Er hat mit einem Stich in die Brust dafür bezahlt, aber plötzlich hat der Reitertrupp aus Beth’narn vor ihm gestanden. Sechzehn Krieger und fünf der riesigen Hunde, und als er sein Schwert hat ziehen und es zum Zeichen seiner Kapitulation vor sich legen wollen, hat ihn der größte davon angesprungen und seine Hand zermalmt. Vieles von dem, was danach passiert ist, ist verschwommen, er kann sich kaum an den Weg erinnern, aber es ist nicht weit gewesen, sie sind noch am Abend des gleichen Tages vor dem Tor eines Hauses angekommen. Da hat er sie das erste Mal stehen sehen.
Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, in einem schlichten gelben Kleid. Sie hat sehr dunkles Haar gehabt, fast schwarz, es war in Flechten wie eine Krone um ihren Kopf gelegt, ein paar Löckchen haben sich um ihre Stirn und ihre Wangen gekringelt. Und sie hat Augen gehabt in der Farbe des Steins, aus dem die Statue geschnitten ist, die zuhause auf seiner Truhe steht. Jadin, so nennt der Yen-Meister den Stein, und ihre jadingrünen Augen haben sehr traurig auf den Körper des jungen Mannes geblickt, der tot über dem Sattel seines Pferdes gelegen hat. Dann hat sie ihn angeblickt, nur für einen Moment, und er hat gemeint, er kennt sie, er weiß, wer sie ist. Sie haben ihn weitergezerrt und an den Block gekettet, sie ist gekommen und hat ihm Wasser gebracht. Er hat ihr in die Augen gesehen und sie bei dem Namen genannt, der ihm durch den Kopf gegangen ist, Deneri, aber sie hat nicht reagiert darauf, und er kennt keine Deneri, er kann sich nicht erinnern, je eine gekannt zu haben. Es ist kein Name, der in Beth’anu geläufig ist. Sein Vater weiß, woher er ihn kennt, er wird es ihm auch sagen. Aber nicht jetzt, erst später, wenn es seinem Erstgeborenen wieder gutgeht. Jetzt muss er wieder schlafen, in ein paar Tagen werden sie ihn zurückbringen in die Zimmerflucht des Sa’Rimar in der Feste des Thain. Dann ist immer noch Zeit genug dafür.
Aber er teilt Tenaros Sorge um das Wohlergehen der jungen Frau, sie hat ihm geholfen. Der Heermeister von Beth’narn ist als kalter, oft unbeherrschter Mann bekannt, wenn er herausfindet, dass sie ihm die Flucht ermöglicht, ihm sogar ihr eigenes Pferd überlassen hat, wird er sie bestrafen. Und er straft hart, er erinnert sich noch an die junge Frau, die eine Zeitlang im Haus des Barar von Beth’kalar gelebt hat. Sie war die jüngste Schwester des Heermeisters, reisende Händler haben sie in der nördlichen Sandwüste in der Nähe eine Oase gefunden, verzweifelt, krank und halb verdurstet. Er hat ihr das Kind von der Brust gerissen, kaum dass es geboren war, und sie aus dem Haus gejagt, weil sie sich geweigert hat, ihm den Namen des Vaters zu nennen. Später hat sie geheiratet, den Sohn eines Ministers des Mar’thain von Beth’nindra, sie sind sich in Beth’kalar begegnet. Sie ist mit ihm glücklich geworden. Und sie ist die Deneri, an die Tenaro sich nicht erinnert, er war erst zwei, als er sie gekannt hat. Und wenn es stimmt, was er sagt, dann ist die junge Frau, die seinen Sohn vor dem sicheren Tod bewahrt hat, das Kind, das der Heermeister ihr aus den Armen gerissen hat. Aber in seinem Haushalt gibt es keine junge Frau mehr mit dunklen Haaren und jadingrünen Augen.
Der Thain wäre ein schlechter Herrscher, wenn er sich nicht die Möglichkeit verschafft zu erfahren, ob von dem Land, das sein Thainan schon zweimal angegriffen hat, eine Gefahr ausgeht. Auch Tenaros Vater hat seine Spione, und er bezahlt sie gut. Nicht in Beth’nindra, seine Frau ist die Schwester des regierenden Mar’thain, die beiden Länder unterhalten wie die Familien freundschaftliche Beziehungen. Sie besuchen sich gegenseitig, es gibt wenig, was dem anderen verborgen bleibt. Aber in Beth’narn sogar zwei, sie wissen nicht einmal voneinander. Sie waren dieses Mal gewarnt, als die Armee von Beth’narn einmarschiert ist, der Thain hat seine Armee gegen sie gestellt, sie waren ihnen drei zu eins überlegen. Aber der Heermeister von Beth’narn hat nicht nachgegeben, er hat seine Männer gegen sie geschickt, es war keine Schlacht, es ist ein Gemetzel gewesen. Wenige sind dem Heermeister gefolgt, als er endlich genug gehabt und den Rückzug angetreten hat. Es hat Tote gegeben auf beiden Seiten, die grausamen Bestien an der Seite der Männer von Beth’narn haben ihren Tribut gefordert, und sie scheinen neun Leben zu haben wie eine Katze. Sie haben auch wieder genug Verwundete in den blauweißen Umhängen von Beth’narn vom Feld getragen, sie lassen sie einfach liegen. Der Thain von Beth’anu hat ein paar dankbare Untertanen mehr.
Aber die Nachrichten, die den Thain erreichen, klingen nicht gut. Der Fürst von Beth’narn gibt seine Pläne nicht auf, er ist nach wie vor der Meinung, dass Beth’kalar an ihn hätte zurückfallen sollen, als der letzte Barar vor dreißig Jahren ohne Erben gestorben ist. Er wird es noch einmal versuchen früher oder später. Und ja, es hat eine junge Frau mit grünen Augen gegeben im Haushalt des Heermeisters, er hat sie sein Schwesterkind genannt. Dunkelhaarig, schlank, ein bezauberndes junges Mädchen, liebreizend und sanftmütig. Aber sie war nicht mehr anzutreffen bei seinem letzten Besuch, er hat vorsichtig nach ihr gefragt, die Hausherrin hat ihm erzählt, sie lebt nicht mehr hier, sie ist zu Besuch bei der Familie ihres Vaters. Und es wird ein langer Besuch werden.
Wo die angebliche Familie ihres Vaters wohnt, bekommt er nicht heraus, aber so schnell gibt er nicht auf. Und es gibt andere Möglichkeiten, er muss nicht die Hausherrin fragen. Dienstboten tratschen gern, wenn sie sich auf dem Markt beim Einkaufen treffen, der Liebhaber der Köchin steht in seinen Diensten, Händler, die Waren und Lebensmittel ins Haus des Heermeisters bringen, sehen und hören viel. Nach und nach wird klar, was sich wirklich abgespielt hat im Haushalt des Heermeisters. Sein Schwesterkind ist gar nicht verreist, es weiß doch niemand, wer ihr Vater ist. Sie ist nur kein Kind des Haushalts mehr, die Hausherrin lässt sie jetzt als Dienstmagd ihr Brot verdienen. Und so hübsch wie früher ist sie nicht mehr nach den Prügeln, die sie bezogen hat. Die Köchin findet es ungerecht, sie spricht darüber mit ihrem Liebhaber, es ist doch nie bewiesen worden, dass sie es war, die dem jungen Mann zur Flucht verholfen hat. Es muss jemand aus dem Haushalt gewesen sein, sonst hätte der Hund angeschlagen, die Stute ist nicht wie die Schlachtrösser der Männer, sie folgt jedem, der sie am Zügel führt, und die jüngste Tochter hat Mirini nie leiden können, sie ist nicht so hübsch wie sie. Wer weiß, wen oder was sie wirklich gesehen hat in der Nacht. Er hat sie nur auf den Verdacht hin so zugerichtet, aber sie ist ja selbst daran schuld, warum hat sie den Mund nicht aufgetan? Der ganze Haushalt ist drittteilelang in Aufruhr gewesen, langsam kehrt wieder Ruhe ein, und so schlecht scheint es ihr ja nicht zu gehen in ihrer Hütte mit dem Loch in der Mauer als Fenster.
Mirini. Tenaros Vater fragt ihn, ob er sich an den Namen erinnert, er hat ihm erzählt, dass der Sohn des Heermeisters sie geschlagen und beschimpft hat. Hat er sie da bei diesem Namen genannt? Aber Tenaro kann sich nicht erinnern. Es ist ihm schlecht gegangen, das Wasser, das ihm die junge Frau gebracht hat, hat kaum einmal gereicht, seinen Durst zu stillen, er hat Hunger gehabt, Fieber, Schmerzen, er hat sich immer öfter zurückgezogen auf die Suche nach seinem Yen’gi. Gefunden hat er es, als er gespürt hat, wie seine Hand von seinem Arm getrennt wird, danach erinnert er sich kaum an etwas. Er hat auf einer dreieckigen Wiese gesessen, in der Mitte zwischen drei stehenden Steinen, es ist dort ruhig und friedlich gewesen. Er hat sich leicht gefühlt, frei, er hat keine Schmerzen gehabt, keine Angst, er hat dort verweilen wollen für immer. Manchmal hat er das Gefühl gehabt, dass er nicht allein ist, dass jemand bei ihm ist, aber er hat nie eine andere Person gesehen, wenn er die Augen geöffnet hat. Er kann sich nicht einmal daran erinnern, ob er mit der jungen Frau gesprochen, ob er ihr gedankt hat für seine Rettung, sie setzt so viel aufs Spiel für ihn. Erst als er am See bei den drei roten Pfählen Metús entsetztes Aufkeuchen gehört hat, hat er wieder zurückgefunden, aber da ist er schon viel zu krank gewesen. Nein, er kann sich nicht erinnern an ihren Namen. Nur an ihre wunderschönen, warmen, jadingrünen Augen.
Читать дальше