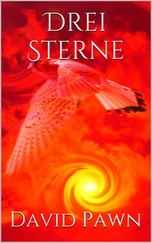Die Menschen in den Oasen begegnen ihnen freundlich, sie bekommen Wasser genug für sich und ihre Pferde, und sie werden eingeladen, ihre Mahlzeiten mit ihnen zu teilen. Sie tragen ihren Teil dazu bei, manches der einfachen Nahrung, die sie mit sich führen, ist eine Delikatesse für die Bewohner. Es sind asonische Brunnen, um die die Oasen entstehen, Metú kennt das Wort aus den Schulstunden, die er neben Tenaro durchlitten hat. Ihr Wasserstand ist immer gleich, sie laufen nicht über, sie sinken nicht ab, und ihr Wasser ist immer klar und frisch. Die Oasen sind umso ausgedehnter, je größer die Brunnen sind, manchmal sind es fast kleine Teiche, manchmal nur ein Loch im Boden, aber es ist immer ausreichend Wasser vorhanden. Der Landkundemeister des Prinzen hat ihnen gesagt, es wird angenommen, dass es ein unterirdischer Fluss ist, der sie speist, er kommt aus Nordwesten und mündet in den See. Es ist einmal beobachtet worden von einem tapferen Mann, der die Strapazen auf sich genommen hat, das nördliche Ende des Sees zu erkunden. Ganz im Nordwesten des Kalar’terla, schon fast an seinem nördlichen Ufer, gibt es eine Stelle, an der das Wasser heller ist als das durchscheinende Grün, es schmeckt anders, und es leben keine Echsen dort, sie scheinen das helle Wasser zu meiden. Hier kann man es auch trinken, es verursacht keine Krämpfe wie das Wasser im restlichen See, aber Menschen können nicht leben hier, das Nordufer des Sees ist von Wüste umgeben. Man kann nicht beides haben im Norden des Kalar’terla, Wasser, das sich trinken lässt, und Land, auf dem sich leben lässt.
Metú fragt nach dem Pferdehändler, aber sie wollen nicht so recht heraus mit der Sprache. Sie machen ein abwehrendes Zeichen, wenn er es anspricht, es kommt ihm bekannt vor, die Mek’tain benutzen fast das gleiche. Bei ihnen heißt es „halte das Schlimme fern von mir“, hier wird es eine ähnliche Bedeutung haben. Und sie können sich nicht einmal vorstellen, dass ein Mensch grüne Augen hat, nur Demoni haben grüne Augen, die Augen ihrer Frauen sind braun. Tiefbraun, so wie die Augen Tenaros, aber ohne die goldenen Funken darin. Er kann gern in sie hineinsehen, sie sind alles, was er sieht von den Frauen der Oasen. Sie tragen Schleier über ihren Köpfen, um sich vor der Sonne zu schützen, nur mit einem schmalen Schlitz über den Augen, aber er sieht nur braun dahinter. Erst in der fünften Oase erzählt es ihnen eine alte Frau, als sie abends am Lagerfeuer flache Brote für sie backt. Ja, sie kennt den Pferdehändler, er lebt zwei Tagesritte entfernt. Er züchtet große schwere Pferde, er bringt sie zweimal im Jahr in den Süden, aber er ist verhasst bei ihnen. Er ist es, der manchmal die Stangen umsteckt, die den Weg weisen, er raubt die reisenden Händler aus mit den Männern seiner Familie, wenn sie sich halb verdurstet kaum noch wehren können. Und er bestiehlt auch sie, wenn er auf seinen Reisen hier durchkommt, Vieh, Früchte und manchmal auch junge Frauen, sie tauchen nie wieder auf. Er verkauft sie an die weißen Schwestern, sie haben ein Haus auf einer Oase ein wenig außerhalb der Perlenschnur der grünen Inseln. Es sind hartherzige Frauen, sie lassen sich das Wasser, das Melak ihnen schenkt, teuer bezahlen. Vielleicht findet er dort die Frau mit den grünen Augen, nach der er sucht.
Jetzt haben sie den Pferdehändler gefunden, Mirini finden sie dort nicht. Romar hat Metú bestätigt, dass sie so heißt, seine Blutschwester Mirini. Sie ist siebzehn gewesen, und sie ist hübsch gewesen. Sie hat ein sanftes, freundliches Wesen gehabt, und die Hunde haben sie geliebt. Sie haben sie nie angeknurrt oder nach ihr geschnappt, sie sind ihren Worten gefolgt. Den Heermeister hat es geärgert, es sind Tiere, die für den Kampf gezüchtet sind, abgerichtet um zu töten, nicht sich hinter den Ohren kraulen zu lassen. Es hat ihren Verdacht bestärkt, dass sie es war, die den Gefangenen befreit hat, Roaq, sein eigener Hund hat neben dem Block gelegen. Er hätte gebellt oder zumindest geknurrt, wenn sich jemand genähert hätte, nur bei ihr hat er nie einen Laut von sich gegeben. Er hat sie geschlagen, weil sie dem Gefangenen Wasser gegeben hat, er soll nicht trinken, es hat Romar ein paar zusätzliche Hiebe von Metú eingebracht, als er es gesagt hat.
Der Pferdehändler ist ein mürrischer Mann, er macht ihnen als Erstes klar, es ist seine Familie, der die Oase gehört. Und das Recht auf das Wasser, sie können einen Beutel haben für jedes Pferd, einen halben für jeden Mann, aber essen werden sie nicht mit ihnen. Er liebäugelt mit den Pferden, es sind schöne, selbst nach dem langen Weg durch die Wüste immer noch gepflegte und starke Tiere, aber mit den Schwertern der Soldaten legt er sich lieber nicht an. Sie sehen aus, als ob sie ihr Handwerk beherrschen, und der große Mek’ta wirkt wie jemand, mit dem nicht gut Frucht tauschen ist. Er verhält sich unfreundlich und abweisend, aber er gibt Metú die Auskunft, nach der er fragt. Das Geschenk des Heermeisters? Ja, er hat sie mitgenommen, aber sie ist nicht mehr hier. Sie war zu nichts nutze, sie hat nichts gekonnt. Kein Zelt aufbauen, keine Nahrung bereiten, keine Kleider flicken. Seiner Frau nicht beistehen, als das Kind geboren worden ist, er hat beide fast verloren, weil sie so ungeschickt war. Er ist ein armer Mann, die weißen Schwestern, die einen halben Tagesritt entfernt im Westen leben, lassen sich ihre Dienste teuer bezahlen, er hat nicht nach ihnen schicken wollen. Nicht einmal fürs Bett hat sie getaugt, sie war hässlich, und wenn sie ihn angesehen hat mit ihren grünen Augen, ist es ihm kalt den Rücken heruntergelaufen. Er hat nicht bei ihr gelegen, was wenn sie ein Demoni aus der Hölle ist? Die haben solche Augen. Nicht einmal Melak hätte ihn vor ihr beschützen können, sie hätte seine Männlichkeit verdorren lassen, das war es ihm nicht wert. Es gibt genug willige Frauen in der Oase. Er hat sie weggeschickt, nicht lange nachdem seine Frau fast gestorben ist unter ihren Händen, er hat ihr einen Magen mit Wasser gegeben, sie in die richtige Richtung gedreht und mit der Peitsche aus der Oase gejagt. Vielleicht hat sie es geschafft bis zum Haus der weißen Schwestern, vielleicht auch nicht, wen kümmert‘s? Er ist froh, dass er sie los ist.
Metú hat geseufzt, das wird ja schlimmer als eine der Bänderjagden, die die Thaini früher manchmal veranstaltet hat, wenn eines der Kinder Geburts-fest hatte. Gelbrote Bänder, gebunden um einen Zweig im Apfelbaum, um die lange Nase des seltsamen steinernen Tiers, aus dessen Rücken das Wasser in den Brunnen im Hof läuft, um den Schaft der Lanze eines Wachpostens. Der hat dann grinsend Habacht gestanden, wenn sie es aufgeknüpft haben. Um den Pfosten des Banners auf dem Wehrgang der Feste, um den Stängel einer Blüte im Garten, und wenn sie sie dann genug gescheucht hat, treppauf, treppab, über den Hof, durch den Garten, über den Wehrgang, dann haben sie am Ende der Jagd einen gedeckten Tisch gefunden, mit süßem Kuchen und leckerem Tee. Und den Geschenken für das Geburtsfestkind, Metú weiß bis heute nicht, wie Tenaro es geschafft hat, das junge Pferd für Danuro in den Pavillon im Garten zu bringen.
Sie verbringen die Nacht in der Oase, aber sie schlafen mit ihren Schwertern neben den Händen, und Metú stellt doppelte Posten auf. Sie trauen den Bewohnern der Oase nicht, den Männern nicht und auch nicht den Frauen. Auch sie tragen die haubenartigen Schleier, sie sehen nichts als die Augen von ihnen, und ein Paar von ihnen sind grün. Nicht das satte Grün des Steins der Statue auf Tenaros Truhe, ein helles, durchscheinendes Grün, wie das Wasser des Kalar’terla oder das Glas, aus dem Fläschchen für Medizin gemacht sind, und sie glitzern gierig. Wegen der Pena, die aus einem geplatzten Sack gekullert sind, wegen der Schlafdecken, gewebt aus dunkelbrauner Wolle, weich und wärmend, und die Skorpione scheinen sie nicht zu mögen, sie haben nie einen darin gefunden, wegen der Plättchen in dem Beutel, aus dem Metú zwei Bündel Heu für die Pferde bezahlt. Sie brechen früh auf am nächsten Morgen, der Pferdehändler verweigert ihnen, noch einmal Wasser zu schöpfen, aber sie haben noch genug. Es wird reichen für einen halben Tagesritt, und Metú hat genug Plättchen, um zu bezahlen, was die weißen Schwestern für das Wasser verlangen. Sie sind erleichtert, als sie auf eine Stange treffen, um die ein weißes Band geknüpft ist, sie reiten in die richtige Richtung. Hoffentlich, dem Pferdehändler ist zuzutrauen, dass er die Stangen umgesteckt hat, um doch noch an den Inhalt der Beutel in Metús Truhe zu gelangen. Soll er es versuchen, er wird ihn teuer bezahlen müssen. Aber die Pferde wittern das Wasser schon, sie sind auf dem richtigen Weg. Und er endet vor einem Zaun. Das haben sie nicht erwartet mitten in der Wüste, er ist gebaut aus den oberen Panzern der großen Echsen, die im Kalar’terla leben. Sie werden manchmal am Ufer des Sees gefunden, sie sind leicht aber hart, und zu nichts zu gebrauchen, weil man sie nicht bearbeiten kann. Nicht teilen, selbst ein Schwert zerbricht an ihnen, keine Löcher hineinstechen, und sie sind zu flach, um als Viehtränke zu dienen. Dabei sind sie sogar hübsch, viele kleine Vierecke mit Spiralen darauf. Den einzigen Verwendungszweck, von dem Metú weiß, hat Tenaro herausgefunden, er benutzt sie als Unterlage, wenn er im Drat’kalar einen schneebedeckten Hang herunterrutscht. Ihm ist es ein wenig sinnlos erschienen, erst rutscht er runter, dann klettert er mit dem Panzer unter dem Arm wieder hinauf, nur um wieder runterzurutschen, aber es hat Spaß gemacht, als er es auch einmal versucht hat. Und prompt in einer Schneemauer gelandet ist, Tenaro hat sich ausgeschüttet vor Lachen. Er hat ihn mit Schnee beworfen, sein kleiner Prinz hat zurückgeworfen, und dann haben sie gemeinsam ihre Hände gewärmt an Bechern mit heißem Tee. Metú ist mehr als Tenaros Beschützer, sie sind Freunde, und er wird sich von einem Zaun aus Echsenpanzern nicht davon abhalten lassen, ihm die zu bringen, nach der er sich so sehnt.
Читать дальше