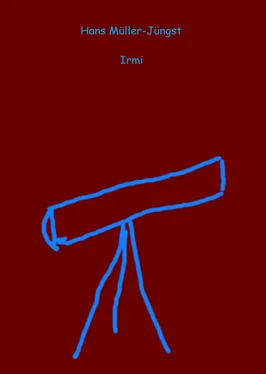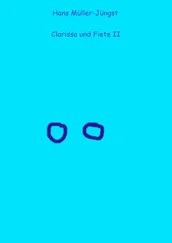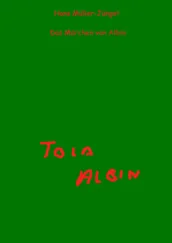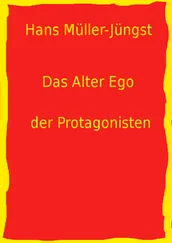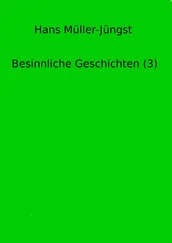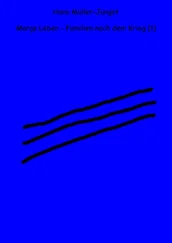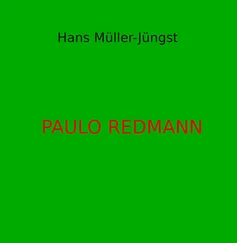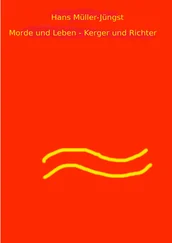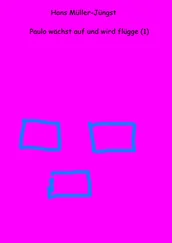Irmi schämte sich danach bald zu Tode und war immer froh, wenn die Beichte vorüber war. Sie sprach anschließend mit ihrer Mutter über die Beichte und brachte ihre Empörung darüber zum Ausdruck, dass der Pfarrer sie mit dermaßen intimen Fragen konfrontiert hatte. Die Mutter antwortete ihr, dass sie darüber nicht großartig nachdenken und dem Pfarrer irgendetwas auf seine Fragen antworten sollte. Sie hätte das in Irmis Alter immer so gemacht und so hätten es auch alle getan, die sie gekannt hätte. Irmi stritt nicht weiter mit ihrer Mutter über diesen Punkt. Sie sah aber nicht ein, was es den Pfarrer anging, ob sie unzüchtige Handlungen an sich vorgenommen hätte, wie er das nannte und nicht weiter darüber nachzudenken, das kam für sie überhaupt nicht in Frage. Für sie war klar, dass der alte Pfarrer geil war und sich an dem, was ihm die Mädchen erzählten, aufgeilen wollte und sie sah nicht ein, dass sie ihn in seiner Geilheit weiter bedienen sollte. Sie beschloss, gegen den Willen ihrer Eltern, nicht mehr zur Beichte zu gehen, auch wenn sie sich dadurch ihren und den Groll des Pfarrers auf sich zog. Beim Küster war sie mit einem solchen Verhalten vollkommen unten durch, für ihn war es gänzlich unnormal und deshalb nicht zu dulden, dass jemand nicht zur Beichte ging, und das hätte es auch noch nie gegeben. Irmi ging noch einen Schritt weiter und meldete sich in ihrer Schule vom Religionsunterricht ab, was von ihren Eltern auch nicht gerne gesehen wurde, sie ließen ihre Tochter aber gewähren.
In der Folgezeit wurden Irmis Gottesdienstbesuche immer seltener, bis sie sie ganz einstellte. Zur Beichte ging sie nie mehr, und sie erklärte Mathi auf dessen Nachfrage hin, warum sie eine solche antireligiöse Haltung eingenommen hatte. Der Küster stand für das Althergebrachte und scheinbar nicht Veränderbare, Unumstößliche. Seine Ansichten standen der Entwicklung des Dorfes zur Moderne hin im Weg. Und das Dorf musste sich entwickeln, wenn es den Anschluss an die neuen Strömungen nicht verlieren wollte und die neuen Strömungen kündigten sich mit den ersten Touristen an, sie begannen, im Dorf Fuß zu fassen. Irmi spürte wie mit ihnen etwas ins Dorf einzog, das es vorher nicht gegeben hatte. Wenn die beiden Touristenpärchen mit ihren Autos vor dem Gasthof „Schneider“ parkten, wirkten sie wie Exoten und belebten mit ihrem Erscheinungsbild die Tristesse, die ansonsten immer im Dorf herrschte.
Hermann Schreiber war ein ähnliches erdverwachsenes Dorfnaturell wie Fritz Lechleitner. Er hatte in seiner Zeit als Gemeindevorsteher viele in die Zukunft weisende Entwicklungen blockiert, weil er sich dem Neuen gegenüber verschloss und dabei alle Alten auf seiner Seite wusste. Er war der Sohn von Adolf Schreiber, der während der NS-Zeit durch antisemitisches Gebaren von sich reden gemacht hatte. Er hatte jüdische Mitbürger in Lerbach zur Anzeige gebracht und so dafür gesorgt, dass sie in die Konzentrationslager abtransportiert wurden. In gewisser Weise sah sich Hermann Schreiber in der Tradition seines Vaters, nur dass er seine Antihaltung nicht gegen Juden, sondern gegen alles Fremde richtete. Jede Entscheidung, die eine Neuerung gebracht hätte, war ihm zuwider und er wusste sich mit aller ihm zur Verfügung stehenden Macht dagegen zu wehren. In seine Amtszeit fielen das kleine Wasserkraftwerk, die neue Umgehungsstraße und die Errichtung zweier Skilifte.
Alles wurde nur gegen seine erklärten Willen gebaut, aber gegen die Mehrheit in der Gemeindeversammlung war er eben machtlos. Hermann Schreiber war ein großgewachsener und streng dreinblickender Mann, dem man schon wegen seiner äußeren Erscheinung Respekt entgegenbrachte. Allerdings hatte er in der Zeit seit seiner Zurruhesetzung davon stark eingebüßt, und auch wenn er noch so grimmig schaute, nahmen ihn selbst die Kinder kaum noch ernst. Auch bei sich zu Hause, wo er bis vor Kurzem noch unumschränkter Herrscher gewesen war, waren die Fronten aufgeweicht und Hermann fügte sich schon einmal den Anordnungen seiner Frau. Die bekam mehr und mehr Oberwasser und blickte in dem Maße, in dem Hermann an Einfluss verlor, auf, und man beachtete sie mit einem Mal im Dorf, nachdem sie lange Zeit hinter Hermann abgetaucht gewesen war. Hermann wurde ein verbitterter alter Mann, nachdem seine Zeit eigentlich abgelaufen war und so manches Gemeinderatsmitglied musste an seine Zornesausbrüche während der Versammlungen zurückdenken, wenn er Andersdenkende rüde zurückzuweisen trachtete und seine Stimme dabei eine Lautstärke erreichte, dass man sie draußen auf der Dorfstraße wahrnehmen konnte.
Sein politischer Stil war autoritär und insofern erinnerte er stark an seinen Vater. Er zeigte sich völlig uneinsichtig, wenn man demokratisches Verhalten bei ihm einklagen wollte. Hermann Schreiber pflegte solchen Mahnern immer entgegenzuhalten:
„Ein starkes Dorf braucht einen starken Führer!“, was die so Angesprochenen gleich zum Schweigen brachte. Seine Nachfolge trat sein Sohn Walter an, der aus dem gleichen Holz geschnitzt war wie sein Vater, dennoch wählte ihn die Gemeindeversammlung zum Gemeindevorsteher. Allerdings war Walter nicht ganz so starrköpfig und verbohrt wie sein Vater und stand zum Beispiel dem Bau eines Freibades nicht im Wege. Die Finanzen von Lerbach waren zwar denkbar knapp bemessen, aber es gab Zuschüsse vom Kreis und vom Land. Ein Freibad würde den Freizeitwert des Dorfes um ein Vielfaches steigern und vielleicht auch den Sommertourismus fördern. Im Übrigen hatten natürlich alle Kinder ihren Spaß, sie würden in den Sommermonaten aus der Schule kommen, ihre Hausaufgaben erledigen und schnell ins Freibad stürmen.
Hans Holzmoser war der dritte der verbitterten Alten im Bunde und wurde nach seiner Pensionierung aus dem Schuldienst immer starrköpfiger, genau wie die anderen beiden, wobei Fritz Lechleitner als der Jüngste noch als Küster im Dienst war. Die jungen Leute, die heute in Irmis Alter waren, konnten sich noch gut an das strenge Schulregiment von Lehrer Holzmoser erinnern. Er war ein Lehrer von altem Schrot und Korn und im Geiste noch sehr der Zeit des Nationalsozialismus verhaftet, wenngleich er selbst diese Zeit nicht mehr miterlebt hatte. Sein Vater war aber zu dieser Zeit Lehrer an der Dorfschule und ein glühender Verehrer Hitlers, er hatte von dieser Verehrung etwas auf seinen Sohn übertragen. Irmi wusste noch genau, wie sie damals in die Klasse von Lehrer Holzmoser ging, und er die Kinder alle zu Beginn des Unterrichts strammstehen ließ. Wenn ihm dabei die Körperhaltung eines Kindes nicht gefiel, ging er zu ihm und brüllte es an, bis das betreffende Kind in seine Augen stramm genug stand. Auch die Schläge, die Lehrer Holzmoser auszuteilen wusste, hatte Irmi in guter Erinnerung, so wie damals bei Daniel. Daniel Bircher war in Irmis Klasse und hatte mit seinem Sitznachbarn gequatscht. Er war derjenige, der dem Lehrer auffiel, seinen Nachbarn hatte er gar nicht zur Notiz genommen. Daniel musste aufstehen und nach vorne kommen, und noch bevor er an der Tafel stand, schlug Lehrer Holzmoser ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Der Schlag war mit einer solchen Wucht ausgeführt worden, dass Daniel einige Schritte zurücktaumelte, und sich die fünf Finger der Schlaghand des Lehrers auf seiner Wange abzeichneten. Daniel stand kurz davor, loszuheulen, konnte sich eine Weinen aber verkneifen und schlich wieder zu seinem Platz zurück. Alle Mitschüler musterten ihn und beobachteten seine Wange, die Fingermale verschwanden aber nach und nach wieder. Daniel hatte sich nicht getraut, zu Hause von den Schlägen zu erzählen, weil die Schläge natürlich auch eine Ursache hatten, und die lag bei ihm. Lehrer Holzmoser ging unmittelbar nach der Schlagattacke zum Unterricht über, denn für ihn war es nichts Besonderes, seine Schüler zu schlagen, wenn sie seinen Unterricht störten. Er hielt sich aber bei den Mädchen zurück, wenn die Mädchen quatschten, schrie er herum und schüchterte sie auf diese Weise ein. Alle Schüler hatten Angst vor ihm und er musste nicht befürchten, von den Eltern wegen seiner Brutalität Kontra zu bekommen, im Gegenteil, manche Eltern ermutigten ihn sogar, ruhig einmal kräftig zuzulangen, wenn ihr Spross sich danebenbenahm.
Читать дальше