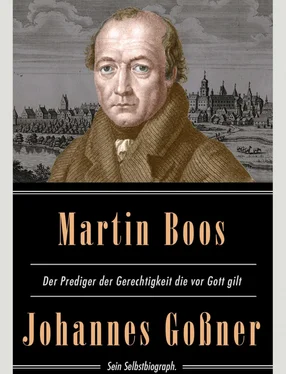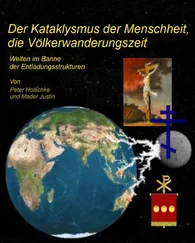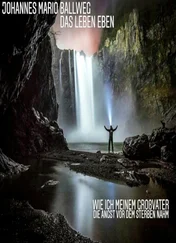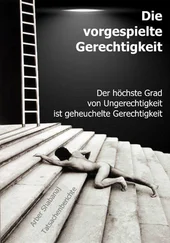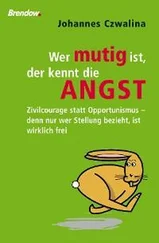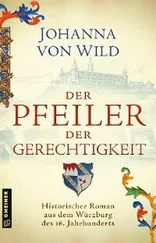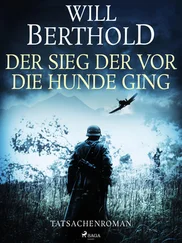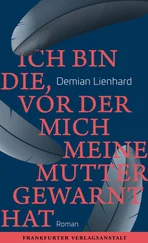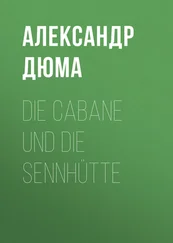Die Veranlassung war diese. Boos war nun schon so allgemein bekannt und verschrieen, dass er und seine Sache in Kirchengeschichten aufgenommen wurde. So erschien 1809 der Huthische Versuch einer Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, worin Boos und seine Geschichte auch einen Platz erhielt und wie es sich von selbst versteht, weil der Verfasser ihn gar nicht kannte, sondern nur von Hörensagen schrieb, unter die Schwärmer gestellt wurde.
Dagegen erhob nun der verehrte Freund und ehemalige Lehrer des verschmähten Zeugen der Wahrheit seine Stimme und schämte sich nicht der gelästerten Wahrheit, nicht des mißkannten und verworfnen Zeugen. Er ließ Folgendes in die Feld. Litt. Zeitung einrücken.
Freundlicher Beitrag zum Huthischen Versuche einer Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts 1809.
Es wird im zweiten Bande dieses Versuches S. 374 und 375. erzählt, dass Herr Kanoniker Martin Boos, (jetzt Pfarrer) im Jahre 1797 mehrere schwärmerische Sätze, wovon sieben angeführt werden, verteidigt, und nachmals, einem Spruche des Vikariats zu Augsburg zu Folge, abgeschworen hätte, und zur Nachholung des vernachlässigten theologischen Studiums wäre angewiesen worden etc. Da diese Erzählung den vortrefflichen noch lebenden Mann, der durch Taten und Leiden gleich bewährt, von Schwärmerei, wie von Leichtsinn gleich weit entfernt ist, und überdies als Pfarrer einer Gemeinde von 5000 Menschen seines ungetrübten Ansehens bedarf, in einem ungünstigen Lichte zeigt: so fand Anzeiger dieses, der die ganze Begebenheit genau kennt, sich von der Liebe zur Wahrheit gedrungen, die nötigen Berichtigungen und Ergänzungen der Erzählung, wovon der Verfasser bei einer neuen Auflage seines Entwurfes, ohne Zweifel den besten Gebrauch machen wird, diesem öffentlichen Blatte einzurücken. Die Erzählung wird berichtigt in dem, was sie angibt, und ergänzt in dem, was sie nicht angibt, Beides in möglicher Kürze.
Berichtigungen
Pfarrer Martin Boos hat die genannten Sätze I. gar nie gelehrt, weder in Predigten, noch sonst, weder mündlich, noch schriftlich. Er hat sie II. noch weniger verteidigt. Er hat sie III. am allerwenigsten als seine Meinung gelehrt oder als seine Meinung verteidigt. Er hat sie IV. bloß als Einfälle und Meinungen Anderer im Durchlesen mehrerer Schriften vorgefunden, und einige davon exzerpiert [herausgezogen], andere nicht einmal exzerpiert. Er hat sie V., als ihm aufgetragen ward, sie feierlich zu verwerfen, allerdings verworfen; aber wohl gemerkt, nicht als seine Meinung, noch weniger als seine ausgesprochene Lehre, und schon gar nicht als seine jemals behauptete und verteidigte Lehre, sondern bloß, wie sie da liegen, prout iacent, verworfen und abgeschworen. Er hat VI. eh’ er die Sätze abschwur, ausdrücklich vor dem ganzen hochwürdigen Vikariate protestiert, dass er diese Sätze weder privatim, noch puplice gelehrt habe, also als seine Sache, als seine Meinung unmöglich abschwören könne; worauf ihm der Älteste von den beisitzenden geistlichen Räten, ein sehr verdienstvoller Mann, zur Antwort gab: „So schwören Sie dieselben so ab, wie sie daliegen.“ Nach dieser entscheidenden Erklärung des ältesten Rates fing Boos VII. so an: „Auf Befehl meiner Obrigkeit schwöre ich also diese Sätze ab, aber nicht als meine, sondern als eine fremde Sache.“ Wonach dann die förmliche Abschwörung erfolgte. Dies machte denn auch auf den damaligen Generalvikar Nigg einen so tiefen Eindruck, dass er, als Boos späterhin seine Litteras dimissoriales [Schreiben zur Versetzung] nachsuchte, nicht umhin konnte, die Orthodoxie und die Rechtschaffenheit des edeln Mannes öffentlich und selbst in der Entlassungsurkunde mit diesen Worten anzuerkennen: „Attestamur, henestum ac dilectum in Christo presbyterum Martinum Boos in diversis nostrae dioecesis parochiis cura animarum cum laude parfunctum, nullaque censura ecclesiastica quantum nobis constat, innodatum esse, quem proin omnium, et singularium, ad quos pervenerit, favoribus, et gratiis commendamnus etc.“
Was den mit eingewebten Vorwurf des vernachlässigten theologischen Studiums betrifft, so wissen VIII. seine Lehrer (er studierte an der Universität zu Dillinen, zu einer Zeit, wo das philosophische und theologische Studium daselbst in seiner schönsten Blüte war) das Gegenteil; sie sind erbötig, es öffentlich zu bezeugen, und haben es schon öffentlich bezeugt. Sein Absolutorium, das ihm die Universität erteilte, ist buchstäblich wahr:
„Cum igitur Rev. ac doctissimus D. Martinus Boos Huttenriedensis Algoius, sacerdos, modo Kooperator in Waldneukirchen studiorum morumque testimonia petierit, praesentibus hisce testamur, eudem in hac alma episcopali Universitate studiis philosophicis diligentiam constanter maximam et indefessam ita impendisse, ut primus omnium Magisterii philosophici corona decorari promeritus fuerit, eumque pari diligentia scientiis theologicis ita vacasse, ut ex studio, morali, et pastorali, item ex iure ecclesiastico secundum cl. Gmeineri institutiones tradito progressus notam primam in classe prima vel eminentiae retulerit. Scientiae ornamentis iunxit mores probatissimos plurima laude, omnique commendatione dignos etc.“
Dies Alles, und andere einzelne Ereignisse, die hier anzuführen zu weitläufig wäre, weiß der Anzeiger dieses als die gewisseste Wahrheit aus den zuverlässigsten Quellen, aus den Tagebüchern der Untersuchung, aus den sämtlichen Fragen und Antworten, und aus der innigsten Bekanntschaft mit der ganzen Begebenheit.
Ergänzungen.
Aber, woher kam denn die bischöfliche Untersuchung, und der Auftrag des Vikariats? Wodurch wurde sie veranlasst?
Antwort: Jene Untersuchung und dieser Auftrag kamen daher, und wurden dadurch veranlasset:
Der damalige Kaplan (jetzt Pfarrer) Boos, durchdrungen von dem Geiste des lebendigen Christentums, das in Polykarpus, Ignatius, Cyprianus, Augustinus, Salefius, Fenelon etc. und in allen wahren Christen so herrliche Früchte des heiligen Lebens darstellte, sprach als Prediger, als Gewissensrat, am Krankenbette, und wohl auch im Privat-Umgange, dasselbe katholische Christentum mit solcher überwiegenden Kraft und mit einer solchen Überzeugungsfülle aus, dass viele, viele empfängliche Gemüter durch die Macht der Wahrheit ergriffen, aus dem toten Wesen des Buchstaben in das Leben des Geistes übersetzt wurden, und in ihrem Wandel das innere lebendige Christentum offenbarten. Die ihn hörten, und der Wahrheit nicht gewaltsam widerstanden, wurden von dem Feuer der heiligen Beredsamkeit hingerissen. Eingeweiht in den Geist des Apostels Paulus, sprach er, wie dieser schrieb, von Gott, von Christus, von dem heiligen Geiste, von der Kirche und der Buße, von dem Worte Gottes und dem Glauben, von der Liebe und den guten Werken, von dem Frieden des Gewissens und der ewigen Seligkeit. Die Glieder dieser himmlischen Kette waren die Glieder seiner Predigt, womit er die horchenden Gemüter umschlang und festband, von der Sünde losriss und zu Gott hinführte. Von Christus ging seine Rede aus, und in Christus endete sie, wie die Briefe der Apostel.
„Christus“, das war seine Lehre, „ist das Heil der Welt: Der lebendige Glaube an Ihn ist Gabe Gottes: Dieser Glaube beweist seine Wirksamkeit in und durch die heilige Liebe: Die Liebe offenbart sich in lauter guten Werken, wie der gesunde Baum durch gute Früchte: wer in Glaube, Liebe, Hoffnung und in guten Werken bis ans Ende beharret, der findet in Christus das ewig selige Leben.“
„Ohne Gott, ohne Christus,“ das wiederholte er unzähligemale und immer eindringender und eindringender, „ohne Gott, ohne Christus kein Heil. Was wären z.B. die guten Werke ohne die heilige Liebe, die sie beseelet, die sie hervorbringt? Was wäre die heilige Liebe ohne göttlichen Glauben, der sie in Bewegung setzt? Was wäre der göttliche Glaube ohne Gnade des h. Geistes? Und den h. Geist, wer gab ihn, als Christus? Und Christus, wie kam er zu uns als aus dem Schoße des Vaters, aus dem Schoße der ewigen Liebe? Und dem, der in Glaube, Liebe, Hoffnung und in guten Werken beharret bis ans Ende, was kann ihm anders werden, als die Krone der Herrlichkeit, die er in stiller Zuversicht und im Frieden des Gewissens schon voraus genießt?“
Читать дальше