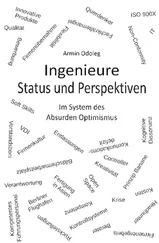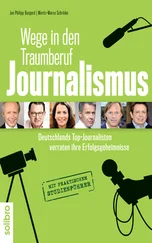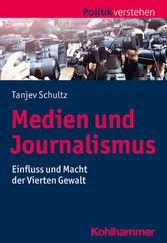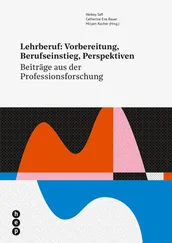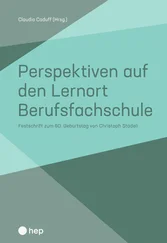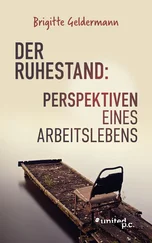o.V. (o.J.): Luci Live-App [Online-Foto] http://www.luci.eu/?page_id=15[03.02.2016]
o.V. (2015): Interview einer Flucht aus der Hölle [online] http://www.bild.de/politik/ausland/zuwanderung/flucht-aus-der-hoelle-das-video-42352374.bild.html[28.01.2016]
o.V. (o.J.): Kostenloser Speedtest für Android: Mit der „CHIP Netztest“-App finden Sie heraus, wie gut Ihr Mobilfunknetz ist. [online] http://beste-apps.chip.de/android/app/chip-netztest-android-app,de.ncqa.floq.chip/[29.01.2015]
Audio – Recorder – ASR [online] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.asr&hl=de[31.01.2016]
Böhm, Marcus (2015): Eine Handyaufnahme vom Silvesterabend in Köln, gegen 22.45 Uhr auf dem Platz zwischen Dom und Bahnhof [Online-Foto] http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/nach-silvester-in-koeln-muss-es-um-die-taeter-gehen-13999062/eine-handyaufnahme-vom-13999171.html[28.01.2016]
Bösch, Marcus (2012a): Das Studio in der Hosentasche – was ist mobile Journalism und wie geht das? [online] http://www.fachjournalist.de/mobile-journalism/[24.01.16]
Bösch, Marcus (2012b): Mobile Reporting [online interaktives iPad-Buch] https://itunes.apple.com/ch/book/mobile-reporting/id498538947?mt=13[22.01.2016]
Buhrdorf, Jens-Olaf (2015): Interview in Detmold [audio] am 22.10.2015
Gabler Wirtschaftslexikon (o.J.) [online] http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/workflow.html[31.01.2016]
Hindenburg Field Recorder [online] https://itunes.apple.com/de/app/hindenburg-field-recorder/id346169165?mt=8[31.01.2016]
Koci Hernandez, Richard / Rue, Jeremy (2012): Mobile Reporting Field Guide [online] http://s3-us-west-1.amazonaws.com/mobilereportingfieldguide/MobileGuide.pdf[28.01.2016]
Krooß, Annika (2016): Interview in Lemgo [audio] am 25.01.2016
Matzen, Nea / Rosenberg, Olaf (2015): Medial, digital, genial? [online] http://www.deutschlandfunk.de/digitaler-journalismus-medial-digital-genial.1184.de.html?dram%3Aarticle_id=304974[28.01.2016]
Miller, Ben (2015): Field Test App: Empfangsstärke am iPhone überprüfen – so geht’s [online] http://www.giga.de/smartphones/iphone-5/tipps/field-test-app-mobilfunk-signalstarke-am-iphone-uberprufen/[29.01.2016]
Müller, Stefanie (2015): „Ötzi-Walk“ – auf den Spuren der Jungsteinzeit [online] http://lippisches-landesmuseum.de/fileadmin/redakteure/dokumente/Oetziwalk.pdf[29.01.2016]
Katharina Zoe Nehrkorn
»Haltet die Uhren an. Vergesst die Zeit. Ich will euch Geschichten erzählen.« – Timm Thaler von James Krüss
Seit Urzeiten erzählen sich die Menschen Geschichten. Vor mehr als 40.800 Jahren entstand die erste Geschichte/ Story: Eine Zeichnung der Welt und weitere Abbildungen in Höhlen. Wissenschaftler gehen von zwei Ansätzen aus: Die Zeichnungen könnten aus religiösen Gründen gemalt worden sein oder eine Art kreativer Sprache darstellen, die aus Symbolen besteht, also eine Form der Erzählung (Sammer, 2014: 19f.).
Seither hat sich das Prinzip des Geschichtenerzählens bewährt, sodass auch heutzutage nicht auf das „Storytelling“ verzichtet wird. Ein Beispiel aus der Werbung ist die „Telekom-Geschichte“, an die wir uns sicherlich alle erinnern:
Ein mittelalter Mann lässt sich an den unterschiedlichsten Orten in einem rosa Tutu fotografieren, um seine krebskranke Frau glücklich zu machen. So erzählt die Telekom-Werbung die Geschichte dieser zwei Personen (Sammer, 2014: 3).
Eine im Vergleich zu den Zeichnungen moderne Form des Geschichtenerzählens ist der Dokumentarfilm.
Die größte Herausforderung besteht darin, zwischen der Realität, die der Dokumentarfilm zeigen soll, und der notwendigen Inszenierung des Dokumentarfilms zu unterscheiden. Eine geeignete Definition für den Dokumentarfilm zu finden, ist aufgrund dieser Herausforderung, die mit unterschiedlichen Definitionen verbunden ist, nicht gerade einfach. Die pure und unverfälschte Realität bekommt man nur durch eine 24/7 Überwachungskamera. Der Kanadier John Grierson hat eine Definition für den Dokumentarfilm entwickelt, auf die sich die Mehrheit der Dokumentarfilmer einigen kann und die auch auf die Webdokumentation angewendet werden kann. Nach dieser Definition ist eine Doku „the creative treatment of actuality“. Durch technische Innovationen hat sich das Geschichtenerzählen im Dokumentarfilm verändert. Auch das Internet, durch das die Webdoku erst möglich wurde, entstand durch die technische Entwicklung (Figl, 2015: 13-64).
Es gibt viele Bezeichnungen, die einem begegnen können, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Von Webdoku über Webdokumentation, Web-Special, Multimedia-Reportage bis zu Webdokumentationsfilm, Webdoc, interaktiver Film und I-Doc ist alles zu finden (Barth, 2011).
Doch ohne Erklärung helfen die vielen Begriffe nicht dabei, herauszufinden, was eine Webdoku eigentlich genau ist.
Anhand der folgenden Symbole sollten die Studierenden sich selbst erklären, was eine Webdoku ist. Viele Merkmale waren relativ offensichtlich und wurden auch direkt genannt, andere schienen jedoch erst nach längerem Nachdenken sinnvoll zu sein. Alles in allem lässt sich die Webdoku relativ gut wie folgt beschreiben:

Abb. 1 Das Buch
Das Buch ist ein klassisches Symbol für das Geschichtenerzählen, also das Storytelling. Jede Webdoku erzählt eine Geschichte und ist somit auch eine journalistische Form des Erzählens (Barth, 2011a).

Abb. 2 Das Internet
Das @-Zeichen steht für das Internet, repräsentiert also quasi das Medium, über das die journalistische Erzählform verbreitet und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Barth, 2011a).

Abb. 3 Die Kamera
Des Weiteren soll das Kamera-Symbol die Multimedialität der Webdoku bzw. der Multimedia-Reportage veranschaulichen. Die Webdoku vereint alle Mediaformen der digitalen Welt. Sie besteht aus vielen digitalen Darstellungsformen, wie z.B. Videos, Fotogalerien, Texten, Infografiken, Karten oder Interviews (Sturm, 2013: 118).

Abb. 4 Das Headset
Das Headset und die Sprechblasen stehen für die Interaktivität einer Webdoku, was auch von den Studierenden genannt wurde. Der User kann aktiv an der Geschichte teilnehmen und ihren Ablauf beeinflussen. Darüber, wie viel Interaktivität in einer Webdoku die richtige Dosis darstellt, herrschen in der Branche geteilte Meinungen. Simon Bouisson formuliert es so: „Besser ist es, wenn der eher faule Zuschauer die Möglichkeit hat, die ganze Geschichte mit wenigen Klicks zu erfassen, während die eher Aktiveren mit dem Inhalt und der Geschichte spielen können. Aber nur, weil wir im Internet sind, müssen wir nicht auf Teufel komm raus die Geschichte zerhacken und alles anwählbar machen, denn dann verliert der Zuschauer den roten Faden.“ (Jour de vote, 2012).
Eine weitere Form der Interaktivität besteht darin, dass der Zuschauer an der Webdoku teilnimmt. Die User können u.a. in Chats mitdiskutieren, Bilder posten oder kurze Audiospuren hochladen, wie z.B. in Bear 71 (Barth, 2013). Es gibt also Kommunikation in Webdokus, und somit ist die Kommunikation dort keine Einbahnstraße mehr wie in den herkömmlichen Medien. Der User sowie die Autoren können direkt auf Kommentare der anderen Nutzer reagieren und ihre Meinungen dazu äußern (Figl, 2015: 68).
Читать дальше