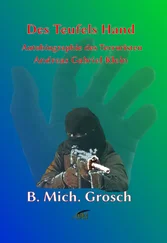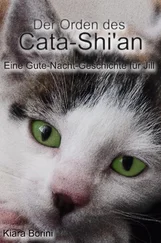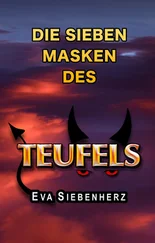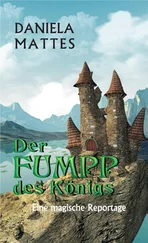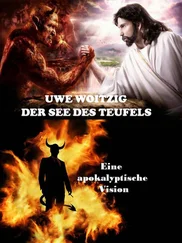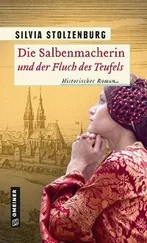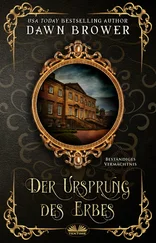»Leider nicht.«
»Na ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich immer zuletzt oder?«
Die junge Frau lachte. »Wenn du es sagst, wird es wohl stimmen.«
»Dann erzähle mal, was du herausgefunden hast.«
»Das verwendete Produkt heißt ›Erdal Dosencreme schwarz‹.«
»Ach du meine Güte. So einfach wollte es uns der Täter nun doch nicht machen. Wäre auch zu schön gewesen.«
»Ja, da hast du leider recht.«
»Er hat also ein schnödes Massenprodukt verwendet, dass es in jedem Supermarkt und Drogerie zu kaufen gibt.«
»Ja«, sie warf nebenbei einen kurzen Blick auf das Computerdisplay, auf dem, seit Stunden, AFIS lief. Aber das Programm war stehen geblieben und zeigte ein Ergebnis an. Aufgeregt sagte sie zu ihrem Gesprächspartner: »Ich glaube, ich habe einen Treffer.«
»Was hast du?«, fragte er verwundert und als sie nicht sofort antwortete, meinte er ungeduldig: »Manuela, sprich mit mir.«
Die Forensikerin hatte mittlerweile einen Blick auf die Anzeige geworfen und den Text überflogen. Sie war auffällig blass geworden, bis sie schließlich zum wartenden Luis Alonso sagte: »Das Ergebnis hat es in sich. Am besten, du kommst ganz schnell in mein Labor.«
»Warum?« Er verstand noch immer nicht.
»Ich habe nicht nur einen Treffer, sondern insgesamt 6 und die europaweit verteilt.«
»Das heißt, überall wurde der gleiche Daumenabdruck gesichert, sowie dieselbe Schuhcreme eingesetzt.«
»So sieht es jedenfalls aus.«
Nach einem kurzen Zögern platzte es schließlich aus dem Kriminalbeamten heraus: »Verdammt, wir haben einen Serienmörder auf der Insel herumzulaufen und das gefällt mir überhaupt nicht.«
»Kommst du jetzt zu mir oder nicht?«
»Bin schon unterwegs«, rief er laut und unterbrach die Verbindung.
Vorzeichen
23.00 Uhr, Observatorio del Teide
Die berühmte Sternwarte Teneriffas befand sich auf dem Berg Izaña auf rund 2400m Meereshöhe. Sie gab es bereits seit einigen Jahrhunderten und wurde von Augustinermönchen um 1701/02 gegründet.
Die ausgezeichneten Bedingungen für die Beobachtung des nächtlichen Sternenhimmels hatten sich allerdings im Laufe der Zeit deutlich verschlechtert. Die stetig wachsende Bevölkerung und die damit verbundene fortschreitende Elektrifizierung der Insel waren für astronomischen Forschungen in der Nacht nicht sehr förderlich.
Deshalb spezialisierte sich das Teide-Observatorium auf die Sonnenbeobachtung in einem Netzwerk mit zahlreichen weiteren Observatorien, die sich weltweit auf sämtlichen Kontinenten verteilten. Nur so war es überhaupt möglich, den Heimatstern rund um die Uhr zu überwachen. Das war beispielsweise für die rechtzeitige Warnung vor Sonnenstürme außerordentlich wichtig, weil diese je nach Stärke eine erhebliche Gefahr für Satelliten, Stromnetze und Kommunikationssysteme darstellten. So kam es wegen der Stürme bereits mehrfach zu sogenannten ›Blackouts‹ in den stromführenden Netzen, was letztlich zu großflächigen Stromausfällen führte.
GREGOR war mit einem 1,5-Meter-Hauptspiegel, das größte Sonnenteleskop. Es wurde hauptsächlich zur Untersuchung kleinerer Strukturen auf der Sonne eingesetzt und war in der Lage Gebilde auf der Oberfläche ab 70 km Durchmesser detailliert darzustellen.
2006 installierte das Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) ein Doppelteleskop mit zwei 1,2-Meter-Hauptspiegel für die Beobachtung magnetisch aktiver Sterne. Diese STELLA-Teleskope wurden autonom, mithilfe von ›Künstlicher Intelligenz‹ (KI), gesteuert.
Der große Vorteil der eingesetzten Technik war, dass eine persönliche Anwesenheit von Wissenschaftlern vor Ort nicht mehr nötig war, um das System zu beaufsichtigen. Sämtliche Steuerungsaufgaben führte im Hintergrund eine spezielle automatisierte Software durch. Ihre Aufgaben beim ordnungsgemäßen Einsatz der Teleskope waren dabei sehr vielfältig. Eine Wetterstation überprüfte ständig Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit, während eine Kamera den gesamten sichtbaren Himmel nach Wolken absuchte. Erst nachdem alle Ergebnisse vorlagen und die Nacht langsam den Tag ablöste, wurde endgültig entschieden, ob sich das Dach der Sternwarte für Beobachtungen öffnete oder nicht. Sollten die Wetterbedingungen tatsächlich akzeptabel sein, übernahm die eingesetzte ›Künstliche Intelligenz‹ die gesamte Steuerung der Teleskope, beginnend von der exakten Positionierung und Fokussierung der Instrumente, bis einschließlich der Nachführkontrolle.
15 Minuten später, Leibniz-Institut für Astrophysik
Die Stille war fast mit den Händen zu greifen. Nur manchmal wurde die Ruhe durch das leise Klicken auf einer Tastatur oder einer Computermaus unterbrochen. Heute hatten insgesamt drei Wissenschaftler, zwei angehende Doktoranden für Astrophysik sowie ein erfahrener Wartungstechniker Dienst. Konzentriert beobachteten die Forscher auf den Displays, die auf jedem Schreibtisch standen, eine Abbildung eines offenen Sternhaufens. Die Aufnahme war sehr detailliert, sodass die Sterne, die unterschiedliche Farbnuancen besaßen, einzeln dargestellt wurden. Wenig später vergrößerte einer der Astronomen den Bildausschnitt noch weiter, bis schließlich in der Mitte des Bildschirms eine winzige Scheibe zu sehen war, die in einem rötlichen Licht strahlte.
Es handelte sich um einen Überriesen vom Typ M mit 20-fache Größe der Sonne und einer Temperatur von 2295 K (2021,85 °C). Das war für Sternenverhältnisse ein sehr niedriger Wert. Allerdings war seit Jahren genau dieser Sternentyp ein vorrangiges Forschungsobjekt der Wissenschaftler. Das lag vor allem daran, dass bereits zahlreiche Sterne vom Spektraltyp M entdeckt wurden, die Planetensysteme besaßen. Durch die geringe Oberflächentemperatur war zumindest theoretisch die Chance gegeben, dass sich Leben auf einem Planeten herausgebildet hatte, vorausgesetzt er umkreiste seinen Heimatstern auf einer nahen Umlaufbahn.
Genau das wollten die Wissenschaftler des Leibniz-Instituts heute Nacht erforschen. Leider wurde ihre Hoffnung bisher nicht erfüllt, ein weiteres Planetensystem zu entdecken. Allerdings musste man bei astronomischen Beobachtungen schon immer eine Menge Geduld aufbringen und häufig hatte es viele Jahrzehnte gedauert, bis endlich ein abschließendes Ergebnis vorlag.
Die Wissenschaftler arbeiteten hochkonzentriert und werteten, jeder für sich, zahlreiche unterschiedliche Daten aus. Nur manchmal rollte einer von ihnen mit dem Bürostuhl zu einem Kollegen hinüber, um sich kurz auszutauschen. Aber das dauerte meistens nicht allzu lange, dann kehrte er wieder zu seinem Arbeitsplatz zurück. Es war abgesprochen, dass sie sich zur Halbzeit ihrer Schicht zusammensetzen wollten, um die neuesten Beobachtungen zu erörtern und die weiteren Schritte festzulegen. Doch bis zur Besprechung waren es noch rund 2 Stunden hin.
Genau in diesem Moment wurden plötzlich die Displays schwarz.
Professor Dr. Markus Lewerenz, der Leiter der Forschungsgruppe, drehte sich sofort zum Wartungstechniker um, der die Funktionsfähigkeit der Teleskope über 3 Monitore überwachte. »Was ist los, Alex? Liegt eine technische Störung vor?«
Der Angesprochene schüttelte den Kopf und erwiderte: »Nein, das Dach der Sternwarte schließt sich gerade automatisch.«
»Warum?«
»Kann ich derzeit noch nicht genau sagen, Professor. Eine Funktionsstörung liegt jedenfalls laut Anzeige nicht vor.«
»Dann bleiben ja nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, entweder der Wind ist zu stark oder es zieht Bewölkung auf. Das kommt ja in dieser Jahreszeit relativ häufig vor. Welche Ursache ist es denn nun?«, fragte er ungeduldig.
»Keine von beiden.«
Lewerenz sah seinen Mitarbeiter verwundert an. »Dann verraten Sie mir mal den Grund.«
»Es findet gerade ein Erdbeben statt, Professor.«
Читать дальше