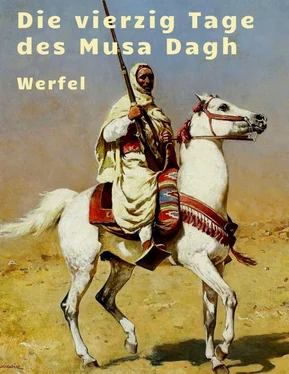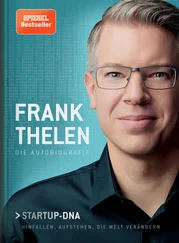»Ich tue ihnen nicht unrecht. Es gibt unter ihnen wunderbare Leute. Ich habe schließlich im Krieg auch das niedre Volk kennengelernt, in seiner Geduld und Güte. Sie sind nicht schuld und wir sind nicht schuld. Aber was hilft das?«
Das Morgengrauen wuchs, und die Linie des Musa Dagh, der in das Schlafzimmer schaute, begann schärfer zu werden. Die Augen Gabriels hingen an dem Berg:
»Ich habe darüber nachgedacht, wie sonderbar es doch ist, daß wir Awetis nachgereist sind und er sich mir immer wieder entzogen hat. Als wenn er mich durch seinen Tod hätte nach Yoghonoluk locken wollen ... Nein! Eigentlich hast du ja darauf bestanden, hierherzugehn.«
Es wurde kalt. Juliettens nackte Füße froren. Friedfertig stimmte sie bei:
»Siehst du? Es war mein Eigensinn. Das kann dich doch beruhigen.«
Gabriels Gedanken aber hatten ein anderes Ziel:
»Gestern habe ich einen Augenblick lang das felsenfeste Gefühl gehabt, daß eine höhere Macht mich leitet, daß Gott irgend etwas mit mir vorhat. Es war wirklich ein felsenfestes Gefühl, wenn es auch schnell vorübergegangen ist ... Das Leben, das ich geführt habe, war wohl nicht das rechte. Es ist so angenehm, sich einzubilden, man sei eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein hervorragendes Staubkorn, das an die Schwerkraft nicht gebunden ist und ohne Verpflichtung im Weltraum vagabundieren darf ... Da hat mich Gott durch Awetis und durch seinen Willen in das alte Land zurückgeführt ...«
Er schwieg. Juliette aber forschte lange in seinen undeutlichen Zügen:
»Ich sehe das erstemal an dir Angst.«
Noch immer wandte er die Augen nicht von dem wachsenden Musa Dagh ab:
»Angst? Wie vor etwas Übernatürlichem! Als Kind habe ich mir oft vorgestellt, daß ein kleines Sternchen am Himmel plötzlich größer wird, anschwillt, näher und näher kommt und die Erde zerdrückt ...«
Er schüttelte sich, um seiner endlich Herr zu werden:
»Juliette! Nicht um mich geht es. Es geht um dich und Stephan.«
Da wurde sie endlich sehr böse:
»Ich glaube an all deine Gefahren nicht. Wir leben im Jahre 1915. Ich habe in der Türkei wie überall in der Welt nur Freundlichkeit und Galanterie erlebt. Ich fürchte mich nicht vor den Menschen. Aber selbst wenn eine Gefahr droht, glaubst du wirklich, ich würde so feig und gemein sein, davonzulaufen und dich sitzenzulassen? ... Das täte ich nicht einmal dann, wenn ich dich nicht mehr gern hätte.«
Er sagte nichts mehr und schloß die Augen. Juliette wollte sich schon leise erheben. Gabriel aber ließ den Kopf in ihren Schoß gleiten. Seine Stirne war kalt und naß. Jäh mit einem Schlag begannen die Vögel ihr morgenschrilles Durcheinander.
Viertes Kapitel: Das erste Ereignis
Diese Anwandlung der Schwäche und Verzagtheit ging so schnell vorüber, wie sie gekommen war. Dennoch schien Gabriel seit dem Tage von Antiochia nicht mehr derselbe. Er, der sonst stundenlang in seinem Zimmer gearbeitet hatte, verbrachte jetzt meist nur die Nächte zu Hause. Dann aber war er sehr müde und schlief wie ein Toter, über das Drohende, das ihn in der letzten Sonntagsnacht so tief verstört hatte, sprach er kein Wort mehr. Auch Juliette vermied es, die Rede darauf zu bringen. Sie war überzeugt, daß nichts Bedenkliches dahintersteckte. In ihrer Ehe hatte sie schon drei- oder viermal krisenhafte Zeiten an Gabriel miterlebt. Wochen einer schweren und grundlosen Verstimmung, Tage eines brütenden Verstummens, das sich durch kein freundliches Mittel lösen und aufheitern ließ. Sie kannte das. In solchen Zeiten wuchs die Wand zwischen ihnen auf, das Fremde, das Unüberwindliche, und sie war dann über ihren kindlichen Mut erschrocken, der sie verleitet hatte, ihr Leben an dieses schwere Blut zu ketten. Freilich, in Paris war es für Juliette anders gewesen. Die eigene Welt, in der Gabriel der Fremde war, stand als Übermacht hinter ihr. Hier aber in Yoghonoluk hatte sich ihre Lage verkehrt, und es ist sehr begreiflich, warum sich Juliette bemühte, bei aller Ironie ihr Wohlwollen für die »Halbwilden« in sich zu verstärken.
Man mußte ihn in Ruhe lassen. In jenem qualvollen Nachtgespräch sah Juliette nichts anderes als wieder eine der Verfinsterungen, die sie schon kannte. Die in unendlicher Sicherheit aufgewachsene Französin besaß nicht die geringste Vorstellungsgabe dafür, was Gabriel den Wüstensturm genannt hatte. Europa war ein Schlachtfeld. Es hieß, daß die Menschen in Paris wegen der Fliegerangriffe ihre Nächte in den Kellern zubringen mußten. Sie aber lebte hier in einem paradiesischen Frühling. Ein paar Monate konnte sie es noch sehr gut aushalten. Und dann würde man schließlich über kurz oder lang in die Avenue Kleber heimkehren. Inzwischen aber gab es für Juliette Arbeit über Arbeit, die ihren Tag auf das schönste ausfüllte. Sie hatte keine Zeit, viel nachzudenken. Ihr Ehrgeiz als Haus- und Gutsherrin war erwacht. Die Dienerschaft mußte zivilisiert werden. Sie bekam Gelegenheit, das ungeborene Talent des armenischen Volkes bewundern zu lernen. Howhannes, der Koch, entwickelte sich in wenigen Wochen beinahe zu einem französischen Küchenchef. Der Diener Missak war so vielseitig, daß Juliette daran dachte, ihn nach Frankreich mitzunehmen. Die beiden Mädchen, die sie in ihren Diensten hatte, versprachen vollkommene Zofen zu werden. Die Villa selbst war in recht gutem Zustand. Jedoch die scharfen Augen einer Frau sahen an manchen Stellen trotzdem Verwahrlosung und Verfall. Handwerker kamen ins Haus. Ihr Meister war ein würdiger Mann namens Tomasian, der alle Zimmermannsarbeit übernahm. Man durfte aber Tomasian keineswegs als Handwerksmeister begegnen, er selbst nannte sich Bauunternehmer, trug eine schwergoldne Uhrkette durchs Leben, an der das von Lehrer Oskanian gemalte Bild seiner verstorbenen Gattin im Medaillon hing, und versäumte ferner keine Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß seine beiden Kinder, Sohn und Tochter, in Genf studiert hatten. Er war auch von einer ermüdenden Gründlichkeit und verwickelte Juliette in langwierige Besprechungen. Dafür aber gelang es ihm, nicht nur die Schäden des alten Hauses in kurzer Zeit zu beheben, sondern auch für gewisse Einrichtungen, so gut es ging, Sorge zu treffen, die abendländischen Gewohnheiten notwendig waren. Die Handwerker arbeiteten geschickt und mit staunenswerter Geräuschlosigkeit. Bereits in den ersten Apriltagen konnte Juliette mit Stolz feststellen, daß sie an der weltabgeschiedenen syrischen Küste ein Hauswesen besaß, das sich ruhig, wenn man die primitive Beleuchtung und Wasseranlage ausnahm, mit jedem westlichen Ruhesitz hätte messen können.
Ihre größte Freude aber war der Obst- und Rosengarten. Hier sprach wiederum ihr Väterblut. Steckt nicht in jedem Franzosen ein erblicher Gärtner und Obstzüchter? Doch auch die Armenier sind geborene Gärtner, zumal die Leute vom Musa Dagh. Kristaphor, der Verwalter, war ein Meister dieses Faches. Juliette hätte die Möglichkeit eines solchen Fruchtgartens nie geahnt. Man erntete beinahe das ganze Jahr. Niemand, der sie nicht gekostet hat, könnte sich eine Vorstellung von der Süße und Saftigkeit armenischer Aprikosen machen. Selbst hier, jenseits der Wasserscheide des Taurus, behielten sie noch die ganze Frische ihrer Heimat oben am gartenreichen See von Wan. Juliette lernte in ihrem Garten immer wieder neue Frucht-, Gemüse- und Blumenarten kennen, von denen sie nie gehört hatte. Die längste Zeit verbrachte sie aber in der Rosenpflanzung, den Sombrero auf dem Kopf und die große Zwickschere Kristaphors in der Hand. Für eine Rosennärrin wie sie war's eine Berauschung, die sich nicht überbieten ließ. Ein weiter Plan, Stock neben Stock, Staude neben Staude, doch nicht in westlicher Exerzierordnung, sondern ein dichter Tumult von Farben und Düften auf dunkelgrünen Wogen. Damaskus war nah und Persien nicht fern. Die tausend Stämme dieser Vaterländer hatten ihre Kinder hierher entsandt, und wenn Juliette auf den schmalen Gärtnerpfaden dieses Meer durchschritt, so grüßte sie mit unzähligen Blicken und Atemzügen der Inbegriff aller Rosenheit. – Apotheker Krikor hatte ihr versprochen, wenn sie ihm genügend viele Körbe von frischen Blüten der echten Moschata damascena zustellen wollte, eine winzige Phiole von jenem Öl auszupressen, dessen Herstellung an jahrhundertealte Bräuche gebunden sei. Und er berichtete auch von einer Legende. Ein einziger Tropfen der echten Essenz besitze eine solche Kraft, daß ein Toter, dem man diesen Tropfen ins Haar tue, noch bei der Auferstehung danach duften und so den Engel des Gerichts für sich einnehmen werde.
Читать дальше