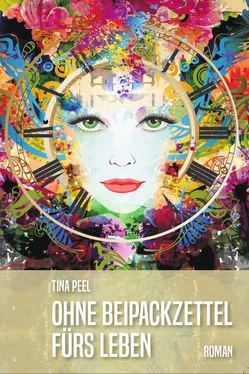Es war einmal … 1935, irgendwo morgens um halb zehn in Deutschland, eine Frau in den Wehen. Das ist keineswegs ungewöhnlich, nur, es ist nicht irgendwer, der Wehen hat, und nicht irgendjemand, der zur Welt kommt. Es ist meine Geburt.
Ich bin gerade dabei, mich wie eine Wurstmischung mit geheimer Gewürzzutat durch den Gebärkanal zu quetschen. Schon wieder! Im Unterschied zur Wurstmasse mit Geheimzutat bin ich auch diesmal nicht weich und anschmiegsam, was wir beide, meine Mutter und ich, zum Heulen finden. Schwieriger als die selbstverständlich schwierige Geburt (die Opferrolle verpflichtet schließlich dazu), sind einmal mehr die Umstände.
Mein Samenspender hat sich schon vor der Geburt in Luft aufgelöst. Er war Soldat, starb aber noch vor Ausbruch des Krieges, die Umstände sind ungeklärt, was bedeutet, vielleicht sind die Umstände ja bekannt, doch niemand hält es für nötig, mich darüber aufzuklären. Welche Lektion hinter seinem frühzeitigen Ableben steckt, darüber könnte ich höchstens spekulieren, dieses Geheimnis nahm er mit ins Grab. Augenblick, hatten wir das nicht schon mal?
Da mein Vater für mich hochgradig inexistent ist, frage ich auch nicht danach. Meine Mutter, ein freundliches, zartes Wesen, hat melancholische braune Augen und braune Haare mit einem Kupferton, den die Sonne so richtig schön zum Leuchten bringt. Leider versteckt sie sie fast immer in einem strengen Knoten unter einem Kopftuch. Für mich ist sie mit und ohne Knoten und Kopftuch die schönste Mutter der Welt. Augenblick, zeichnet sich da vielleicht ein weiteres Muster ab? Mütter mit zarter Konstitution, die unglaublich viel aushalten müssen und über viel innere Kraft verfügen, was sie aber nicht wissen, weil ihre Verpackung irgendwie nicht mit dem Inhalt übereinstimmt? Außen zart und innen hart und muskelbepackt, wie ein Bodybuilder unter Steroiden, aber herzlich?
Wahrscheinlich bleibt einem gar nichts anderes übrig als sich irgendwie durchzuboxen, wenn einem nichts erspart bleibt.
Wenigstens lösen die melancholischen Augen und die zarte Konstitution bei den betuchten Eltern meines verstorbenen Erzeugers Mitleid aus (Oder war es das Pflichtgefühl?). Sie nehmen uns bei sich auf, jedoch nicht als Familienmitglieder. Meine Mutter darf als Dienstmagd arbeiten. Ist ja auch verständlich, schließlich waren meine Eltern nicht verheiratet und ein uneheliches Kind ist zu dieser Zeit ein absolutes No-Go (damals hieß es wohl eher ein Tabu). Da kann man beim besten Willen nicht dazu stehen, was würden da die Nachbarn sagen? Also muss das Kind, alias das Tabu, verheimlicht werden. Warum auch nicht? Wenn es darum geht, Asche auf mein Haupt zu streuen, stehe ich doch gern in der ersten Reihe und rufe
„hier!“.
Zunächst juckt es mich weder, dass ich quasi im Dienstbotentrakt eingesperrt bin, noch, dass ich mucksmäuschenstill sein muss. Mich juckt das Klavier oben im großen Salon, und zwar in den Fingern. Ich möchte dem Zauberding unbedingt Töne entlocken, aber das ist unmöglich. Die Wohnräume der Herrschaft, meiner Großeltern, sind ebenfalls tabu. Ich darf weder ungefragt in ihre Räume, geschweige denn eine Taste des Klaviers drücken. Ich darf überhaupt keinen Ton von mir geben, weder oral, anal, noch musikalisch oder in sonst einer Weise, und das hat einen besonderen Grund. Meine Mutter ist Jüdin. Unehelich geboren zu werden, reichte mir offenbar nicht, der Schwierigkeitsgrad wäre zu niedrig. Aber was soll’s?
Wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, verginge das Leben wie im Schlaf. Was hängen bleibt – und wer könnte das besser wissen als ich –, sind Erfahrungen, die in irgendeiner Weise beeindrucken und auf der Festplatte der Seele Spuren hinterlassen. Ich bin also unwissentlich im Grunde ein aufgewecktes Glückskind, das vom Leben ganz besonders gefördert wird.
Momentan weiß ich bloß, dass ich mich für meine Herkunft schämen soll, wenn auch nicht warum. Auf diesbezügliche Fragen erhalte ich ebenfalls keine Antwort. Es liege jedoch an meinem Blut. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, doch ich weiß, weil man es mir erzählte, dass es davon bei meiner Geburt eine ganze Menge gab. Es war alles voll davon. Seither ist die Konstitution meiner Mutter angeschlagen, was umgangssprachlich ‚ein zartes Wesen haben‘ genannt wird. Wie? Habe ich das noch nicht erwähnt? Natürlich ist sie wegen mir angeschlagen, was denn sonst? Ich bin ein Kind, ich beziehe alles auf mich. Außerdem sagen die anderen das auch. Vielleicht hatte meine Mutter schon vorher eine schwache Konstitution, aber wo bliebe dann die Asche für mein Haupt? Das würde meine Wichtigkeit schmälern. Ich will kein banales Sandkorn am großen Strand des Lebens sein! Augenblick, ist es das?
Könnte die Angst vor Bedeutungslosigkeit ein Grund zum Dramatisieren sein?
Trotz der dramatischen Umstände ist meine Mutter erstaunlich fröhlich, wenn wir zusammen sind. Sie spielt manchmal mit mir auf der großen Wiese in der Nähe des Hauses, jedenfalls in den ersten Jahren. Nach Kriegsausbruch spielt niemand mehr draußen. Sie singt für mich Gutenachtlieder an Abenden, an denen sie mich zu Bett bringen kann. Oft gehe ich aber allein zu Bett, weil sie keine Zeit hat. Ich kann das, bin ja schon ein großes Mädchen. Ich liebe und bewundere meine Mutter und will so werden wie sie, will ebenfalls meinen Mann stehen und stark sein.
Von den anderen Hausangestellten werde ich mit Zuneigung regelrecht überschüttet und verwöhnt. Nur gucken sie mich oft so komisch an, wenn sie meinen, ich sehe es nicht, so, als ob ich krank wäre und sie mich bedauerten. Eine Portion Asche bitte! Ach nein, falscher Alarm. Dabei bin ich doch kerngesund und voller Energie und Tatendrang. Nur doof, dass ich mich aus gegebenem Anlass nicht richtig austoben kann. Das erscheint mir, wenn auch etwas frustrierend, nicht weiter schlimm. Mir ist es wichtiger, es den Erwachsenen recht zu machen, damit sie mich mögen. Mit der Zeit gewöhne ich mich daran, mich unsichtbar und unhörbar zu machen. Nur die Sache mit dem Klavier finde ich ungerecht, man hört ja nicht mich, sondern das Klavier. Soll etwa auch das Klavier unsichtbar und unhörbar sein? Wozu haben sie denn eines? Wäre es meins, würde ich täglich stundenlang darauf spielen.
Die Herrschaft (die Großeltern) ignoriert mich meistens. Bei zufälligen Begegnungen schauen sie mich höchstens streng an und fragen blöde Dinge, ob ich die Hände gewaschen hätte, und als ich älter wurde und zur Schule ging, ob die Hausaufgaben gemacht seien. Das ist alles, was sie interessiert. Sie sagen, ich könne wirklich dankbar sein, aber wofür? Ich mag sie nicht und sie mögen mich nicht. Jedenfalls denke ich das (Hier könnte es jetzt doch ein wenig Asche vertragen. Danke!) Doch ich denke falsch. Ich sehe ihrem Sohn sehr ähnlich und erinnere sie an ihren Verlust. Die Umstände sind nicht nur, was meine Herkunft betrifft, äußerst kompliziert und bedrohlich. An diesem Ort in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts unehelich geboren zu werden, als Kind einer jüdischen Mutter und eines arischen Vaters, ist ganz schön haarig. Aus Angst vor weiteren Verlusten lassen sie sich weder auf meine Mutter, noch auf mich ein.
Doch auch sie denken falsch, wenn sie annehmen, dass das hilft. Sie schließen den Schmerz mit ein, er kann nicht heilen.
Würden sie stattdessen lieben, was das Zeug hält, könnten sie nicht nur den alten Verlust besser verschmerzen. Wenn sie uns am Ende ebenfalls verlören (und das werden sie! Die Dramatik dieser Inszenierung verlangt das!), hätten sie bis dahin Jahre voller Liebe erfahren und schöne Erinnerungen gesammelt, die ihnen niemand nehmen kann. So bleiben ihnen am Ende nur Schuldgefühle aufgrund verpasster Chancen. Also verstecken sie uns genauso wie ihre Gefühle und leben in ständiger Angst vor unserer Entdeckung.
Читать дальше