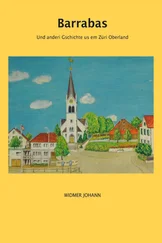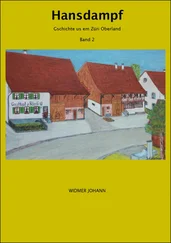Ich war die folgende Zeit völlig versessen auf geschriebene Wörter und sie waren überall.
Da war die „BÄCKEREI TRUNINGER“, etwas schwieriger war das „GASTHAUS ZUM STORCHEN“ aber es wies auf das Storchennest auf dem Kirchturm hin (leider ohne Störche) oder in der Küche war Salz und Zucker, Mehl und Mais angeschrieben. Die Welt hatte für mich eine neue Faszination bereitgestellt.
Beim Abschied am Bahnhof konnte ich dem Opa sogar zeigen, dass da WIESENDANGEN angeschrieben sei, leider nicht ganz richtig. Da sei ein völlig unnötiges „E“, und gleich zwei überflüssige „N“, denn man sage doch WISEDANGE.
Ich habe immer noch das Lachen meines Opas in den Ohren als er sagte: „Na ja, du Besserwisser, du weisst halt noch nicht alles.“
Nach zwei eindrücklichen und glücklichen Wochen musste ich wieder zu meiner Mutter zurückkehren.
Als sie mich am Bahnhof abholte, glaubte ich im ersten Augenblick, es sei die Oma, denn Mutter trug das gleiche schwarze Kopftuch wie Oma. Auch im Gesicht war sie ähnlich, sie war nicht mehr so schwammig wie vorher, ihr Gesicht war hart und scharf gezeichnet und ihr Blick war klar und sicher geworden.
Auch ihre Stimme schien mir verändert.
Dass der Vater nicht mehr hier war merkte ich kaum, ich vermisste ihn nicht.
Aber ich brannte darauf, am folgenden Morgen „meine“ Ida wiederzusehen, denn sie sollte die erste sein, die von meinen Lesekünsten erfuhr.
Sie vernahm die Neuigkeit ohne irgend eine Reaktion zu zeigen. Es interessierte sie nicht.
Ich erklärte ihr, dass ich wisse, dass in jener Büchse auf dem Küchentisch Zucker sei, weil es so angeschrieben sei.
Na ja, das hatte sie auch gewusst, auch ohne lesen zu können.
Sie zeigte auf eine andere Büchse und wollte wissen, was da drin sei.
Ich las ihr so richtig wichtigtuerisch vor: M und das ist ein A und das ein I und zuletzt ein S, also hat es Mais drin.
Da begann sie mich auszulachen und nannte mich einen „Blagöri“, einen Angeber, weil sich nämlich Griess in der Büchse befinde. Sie fand das so lustig und lachte weiter und neckte mich, wegen meiner Leserei, die eh nichts tauge, wenn man Mais von Griess nicht unterscheiden könne.
Ich war so richtig sauer und fühlte mich schwer beleidigt von dieser blöden „Babe“ und schwor mir im Inneren, nie wieder ein Wort an dieses einfältige Ding zu verschwenden. Diese Demütigung erniedrigte mich derart, dass ich etwa eine Woche lang auf mein Honigbrot verzichtete.
Am Samstagabend erschien der Onkel, der eigentliche Besitzer der Schreinerei bei uns und eröffnete uns, dass er mein Vormund sei, also so quasi mein Ersatzvater. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, ich hatte nichts dagegen, denn mein neuer „Vater“ war reich und das konnte zur Abwechslung auch nicht schlecht sein. Meine Mutter hatte vorerst Einwände, aber als er ihr versicherte, sich nicht in meine Erziehung einmischen zu wollen, es sei denn es käme nicht gut, dann könnte sie auf seine Hilfe zählen.
Und in meine Richtung sagte er, dass ich es gut haben werde, wenn ich pariere aber wenn ich Mist bauen täte, dann würde ich in ein Erziehungsheim gesteckt. Aber ich werde schon noch merken, was meine Aufgabe sei, nämlich unsere Schreinerei einst zu übernehmen und das willst du doch?
Ich zuckte nur die Achseln, denn das war wirklich nicht mein Problem.
Da sagte er mit strenger Stimme, dass ich ihm gefälligst antworten solle mit „Ja, oder Nein, Onkel Otto.“
Da war es wieder dieses magische Wort OTTO und ich sagte dem Onkel, dass ich seinen Namen schreiben könne, nahm einen Fetzen Papier vom Tisch und krakelte den Namen OTTO drauf.
Dann erklärte ich ihm, was es auf sich habe mit den zwei T, die nämlich zeigten, dass er ein starker Mann sei.
Der Onkel war sichtlich geschmeichelt und gerührt, aber dann fragte er etwas unwirsch meine Mutter, ob sie mir dieses „Lölizeug“ beibringe. Sie konnte ja nichts wissen und schüttelte verärgert den Kopf.
Aber da hatte ich schon wieder die Initiative ergriffen und fragte meinen Onkel, was das Wort „hört“ bedeute, denn an der Wagenremise unserm Haus gegenüber hing ein graubraunes Plakat mit einem grossen Ohr drauf und quer darüber war geschrieben „Achtung! Feind hört mit!“
Er erklärte mir dann, dass wir anders reden als wir schreiben, wir sagen in unserer Sprache „lose“ aber richtig Deutsch heisse es „hören“. Das war mir etwas zu hoch, aber ich liess es gelten.
Onkel Otto sprach noch eine Weile mit Mutter und, wie ich dem Gespräch hatte entnehmen können, wollte er den Lehrer fragen, ob man mir meine Flausen austreiben solle oder ob man mich fördern müsse.
Die beiden hatten noch einiges zu besprechen als meine Mutter plötzlich auffuhr und schrie: „Der kommt mir gerade Recht, dieser Lindenwirt, dieser verdammte Halunke bekommt jetzt aber etwas von mir zu hören!“
Onkel Otto versuchte sie zu beruhigen aber ohne Erfolg. Schliesslich ging er und sagte beim Abschied, sie solle keinen Blödsinn anstellen.
Am nächsten Morgen zog Mutter ihre „schönen Kleider“ an und auch ich musste mich sauber anziehen. Als die Kirchenglocken zu läuten begannen nahm sie mich bei der Hand und wir gingen mit den andern Kirchgängern Richtung Kirche. Ich war erstaunt, ja sogar fast erschrocken, denn weder sie noch mein Vater haben je die Kirche besucht. Mir ahnte Schlimmes.
Vor der grossen Kirchentreppe machte sie Halt und wartete bis sie im Gedränge den dicken Lindenwirt ausgemacht hatte. Sie steuerte, mit mir an der Hand, direkt auf ihn zu, verstellte ihm dann den Weg und fragte ihn mit überlauter Stimme: „So Lindenwirt, jetzt sagst du mir vor allen Leuten wieviel ich dir schuldig bin.“
Der Dicke stotterte verlegen, das sei doch nicht der Moment … aber meine Mutter blieb hartnäckig vor ihm stehen und wollte, dass er ihr vor all den Leuten Auskunft gebe, denn sie wollte, dass es alle hörten.
Mittlerweile hatte der Wirt sich gefasst und wollte sie beiseiteschieben aber sie wich keinen Schritt zur Seite. Er musste etwas sagen, denn diese Furie war zu allem fähig und so sagte er beschwichtigend: „Na ja, du bist mir eigentlich nichts schuldig „
Hier unterbrach ihn meine Mutter und sagte zu den vielen Leuten die dastanden, sie hätten es alle gehört, dass sie ihm nichts schulde. Aber da fuhr der Lindenwirt weiter und sagte, dass dafür ihr Mann einen mächtigen Schuldenberg zurückgelassen hätte.
Sie erwiderte gereizt lachend, dass er das bitte selber mit ihrem Mann ausrichte, er wisse ja, wo der liege.
Als dann der Lindenwirt zu klagen begann, dass sich die „Leute“ bei ihm besaufen und dann nicht bezahlen wollen, schrie sie ihm ins Gesicht:
„Und du weisst ganz genau wie das geschieht, du lässt sie saufen, ermunterst sie sogar noch mit dem Spruch, dass er anschreiben könne, und dabei weisst du ganz genau, dass sie dann mehr saufen als sie bezahlen können, du verdammter Halunke. Aber der da oben wird dir dann einmal einen Prügel zwischen die Beine knallen. Und jetzt geh da in die Kirche rein, du hast es am nötigsten von uns allen.“
Dann zog sie mich mit sich und wir traten den Heimweg an.
Ich hatte den Vorgang nicht ganz verstanden, aber mir war eines klar geworden, dass meine Mutter eine starke und mutige Frau war und ich war mächtig stolz auf sie.
Dass an jenem Sonntag kein Mensch die Kneipe des Lindenwirts betreten hatte, auch die notorischen Jasser nicht und dass in der folgenden Nacht die „Nachtbuben“, das heisst ein paar junge Leute des Dorfes alle Fenster der Kneipe eingeworfen hatten, vernahm ich erst später von einem, der dabei gewesen war und dabei, als einziger übrigens, ein Schrotkorn in den Oberarm erwischt hatte, weil der Wirt auf die jungen Leute geschossen hatte.
Der „Rössliwirt“ hatte ihr übrigens per Einschreibebrief mitgeteilt, dass er keinerlei Forderungen an sie stellen werde, selbst wenn ihr Mann bei ihm Schulden gehabt hätte, würde er nie der Witwe eines lieben verstorbenen Freundes dafür eine Rechnung stellen, hochachtungsvoll unterzeichnet …
Читать дальше