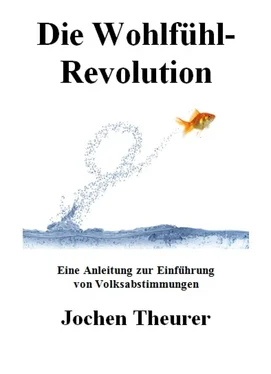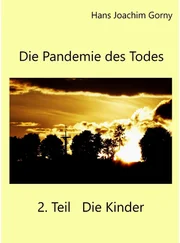Eine neue Partei, die diese Möglichkeit abschaffen will, wird deshalb von den großen Medien entweder ignoriert oder bekämpft werden, Sie wird – anders als die etablierten Parteien – von den reichen Profiteuren des bisherigen Systems auch keine finanzielle Unterstützung erhalten, so dass ein Einzug in den Bundestag erst Recht unwahrscheinlich wird. Denn für einen Wahlerfolg kommt es neben der Präsenz in den Medien heutzutage vor allem darauf an, einen massiven Wahlkampf zu machen. Und das kostet viel Geld.
Die sechs etablierten Parteien geben für ihren Bundestags-Wahlkampf jeweils mehrere Millionen Euro aus. An der Spitze liegt dabei die SPD mit über 27 Millionen Euro. Das ist wesentlich mehr, als jede kleine oder neue Partei zur Verfügung hat. Und genau darin liegt der entscheidende Vorteil der etablierten Parteien.
Die Berufspolitiker haben ihre Gesetzgebungsmöglichkeiten genutzt, um sich in großem Umfang staatliche Gelder zukommen zu lassen. Dabei haben sie stets versucht, den maximalen Vorteil für ihre Parteien herauszuholen und die kleineren Konkurrenten außen vor zu lassen. Die im Parteiengesetz enthaltenden Regeln zur Parteienfinanzierung wurden deshalb schon oft vom Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Chancengleichheit für verfassungswidrig erklärt und aufgehoben.
2011 wurden 141,9 Millionen Euro (ab 2012: 150,8 Millionen Euro) an „Wahlkampfkostenerstattung“ an die politischen Parteien gezahlt. Ob und wieviel eine Partei davon erhält, hängt davon ab, wie viel Stimmen sie bei den letzten Wahlen bekommen und wie viele eigene Einnahmen sie erzielt hat. Diese Regeln sind so ausgestaltet, dass die sechs etablierten Parteien massiv bevorzugt werden.
So erhielten sie 2011 von den 141,9 Millionen Euro insgesamt fast 137 Millionen Euro, was einem Anteil von 96,5 Prozent entspricht. Den Rest teilten sich 15 andere Parteien. Alle anderen Parteien gingen leer aus.
Doch damit nicht genug. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich ausdrücklich nur die staatliche Finanzierung „der Parteien“ reguliert. Das haben die Berufspolitiker als Freibrief genommen, andere Wege zu schaffen, wie sie an staatliche Gelder kommen können. Zum einen haben sie staatliche Zuschüsse an die Fraktionen eingeführt. Diese belaufen sich allein für die sechs Bundestagsfraktionen der etablierten Parteien auf 70 Millionen Euro jährlich.
Offiziell dürfen diese Gelder zwar nicht für die Parteiarbeit ausgegeben werden – aber wer kann das kontrollieren? Und wenn die Fraktion eine Veranstaltung macht, kommt das natürlich auch den Abgeordneten in ihrer Eigenschaft als Parteipolitiker zugute. Die Öffentlichkeit unterscheidet das doch nicht. Durch diese Gelder können sich die Abgeordneten zum Beispiel Mitarbeiter leisten, die ihnen wesentliche Arbeiten abnehmen, was ihnen auch im Wahlkampf zugute kommt.
Hinzu kommen staatliche Gelder für die „politischen Stiftungen“. Jede der etablierten Parteien hat eine ihr nahe stehende „politische Stiftung“. Diese bieten Seminare an, erstellen Broschüren usw. Dafür erhalten die „politischen Stiftungen“ staatliche Zuschüsse in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro jährlich. Wie dieses Geld verteilt wird, ist nicht gesetzlich geregelt. Die etablierten Parteien haben sich jedoch unter der Hand darauf verständigt, dass nur die Stiftungen derjenigen Parteien Zuschüsse bekommen, die seit mindestens zwei Legislaturperioden im Bundestag vertreten sind. Für die Praxis heißt das, dass die 300 Millionen Euro zwischen den „politischen Stiftungen“ der sechs etablierten Parteien aufgeteilt werden. Alle anderen Parteien gehen wieder leer aus.
Dieses Vorgehen ist offensichtlich rechtswidrig. Die PDS klagte deshalb in den 1990er Jahren dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht. Nachdem aber die ihr nahe stehende Rosa-Luxemburg-Stiftung dann auch Staatszuschüsse bekam, nahm sie die Klage wieder zurück. Die anderen Parteien und die „einfachen“ Bürger können dagegen nichts unternehmen.
Dadurch erlangen die etablierten Parteien enorme finanzielle Vorteile. Zum einen werden sie von den politischen Stiftungen unterstützt. Zum anderen können dort „verdiente“ oder abgewählte Parteigenossen mit gut dotierten Posten zwischengeparkt werden, die dann zugleich ihre Kraft für die Partei einsetzen können – staatlich finanziert und natürlich auch im Wahlkampf.
Auf diese Weise umgehen die Berufspolitiker bewusst die vom Grundgesetz und dem Bundesverfassungsgericht eingeforderten Grundsätze der Chancengleichheit und Gleichbehandlung aller politischen Parteien.
Sollte den Berufspolitikern doch einmal unbotmäßige Konkurrenz erwachsen, die sich trotz der vielen Diskriminierungen dauerhaft in den Parlamenten festzubeißen droht, haben die Berufspolitiker die Möglichkeit, diese Parteien gezielt mit staatlichen Sanktionen zu attackieren.
So können sie zum Beispiel eine konkurrierende Partei vom Bundesverfassungsgericht verbieten lassen. Allerdings spielt das Bundesverfassungsgericht da nicht immer mit, wie der Fall der NPD gezeigt hat.
Viel einfacher ist es deshalb, eine neue Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das können die Berufspolitiker in ihrer Funktion als Innenminister selbst veranlassen. Und schon die bloße Erwähnung einer Partei im Bericht des Verfassungsschutzes kann katastrophale Auswirkungen für die Partei haben. Zum einen schreckt das potentielle Wähler ab. Zum anderen müssen die Mitglieder und Kandidaten dieser Partei mit erheblichen sozialen und beruflichen Nachteilen rechnen, besonders wenn sie im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.
Selbst wenn die Partei gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz erfolgreich gerichtlich vorgeht, wird ihr das nichts nutzen. Bis zu einer Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht vergehen viele Jahre. Bis dahin sind die meisten fähigen und engagierten Mitglieder resigniert ausgetreten und in der Öffentlichkeit hat sich der zweifelhafte Ruch der Verfassungswidrigkeit festgesetzt.
Auf diese Weise wurden zum Beispiel die Republikaner politisch ausgeschaltet. Die Republikaner wurden 1983 von ehemaligen CSU-Mitgliedern als rechtskonservative Partei gegründet. 1989 zogen sie mit jeweils mehr als 7 Prozent der Stimmen ins Berliner Abgeordnetenhaus und ins Europaparlament ein und gewannen viele Mitglieder. In der CDU gab es Stimmen, die mit den Republikanern koalieren wollten. Allerdings hatten sie bei der Europawahl in Bayern mehr als 14 Prozent erreicht und die CSU auf 46 Prozent gedrückt.
Da die CSU um ihre damals noch als sicher geltende absolute Mehrheit in Bayern fürchtete, beschloss die CDU, dass es nie zu Koalitionen mit den Republikanern kommen dürfe. Als die Republikaner dann auch bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zum Teil mehr als 10 Prozent erzielten und eine immer größere Öffentlichkeit erreichten, wurden sie ab September 1989 von den nordrhein-westfälischen und den hamburgischen Verfassungsschützern beobachtet. Bei den Wahlen im Jahr 1990 konnten sie die Fünfprozent-Hürde nirgends überspringen. Dann erzielten sie 1992 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg jedoch mehr als 10 Prozent der Stimmen.
Obwohl keine neuen Erkenntnisse vorlagen, beschlossen der Bundesinnenminister und alle Innenminister der Länder daraufhin, die Republikaner vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Das sollte die Partei als rechtsextrem stigmatisieren und gemäßigte Wähler abschrecken. Zudem war dadurch die Grundlage geschaffen, um Mitglieder und Mandatsträger der Republikaner aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Das traf die Partei deshalb besonders hart, weil viele ihrer Mitglieder Polizisten und Soldaten waren.
Diese Maßnahmen der Berufspolitiker waren erfolgreich. Die Republikaner konnten seitdem nur noch einmal in ein Landesparlament einziehen, 1996 in Baden-Württemberg. Bei allen anderen Wahlen sind sie an der Fünfprozent-Hürde gescheitert. Seit 2007 sind sie nicht mehr im Verfassungsschutzbericht aufgeführt. Trotzdem sind sie mittlerweile politisch „verbrannt“. Bei der Bundestagswahl 2009 erhielten sie gerade noch 0,4 Prozent der Stimmen.
Читать дальше