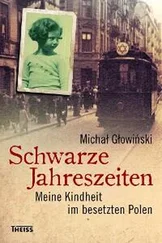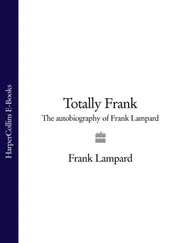1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 „Ich mag Friedhöfe, aber am liebsten mag ich das Meer.“
„Egal jetzt, weiter.“ Sie geht über den Heinrichplatz Richtung Michaelskirche. Ihre rechte Hand steckt in der Handtasche und umschließt den Revolver. Schleyer folgt ihr, und sie achtet drauf, dass er sich links von ihr hält. Sie wendet ihr Gesicht ab, wenn sie anderen Passanten begegnen. „Flüsse?“
„Wenn sie mich an das Meer erinnern würden, dann würde ich sie wohl mögen, aber das hat noch keiner geschafft.“ Er zieht den Ärmel nach unten. „Mississippi, der könnte es schaffen.“
Sie umklammert den Revolvergriff, spürt die Riefen in der Handinnenfläche. „Wir gehen zum Friedhof.“
„Auch gut“, sagt Schleyer, und als sie vor der Michaelskirche stehen: „Diese Kirche hat keinen Friedhof.“
„Ja wo ist er denn hin?“
„Zu kompakt.“ Schleyer gräbt mit einer Drehbewegung der Verse den Stiefelabsatz in den Boden. Er bückt sich, zerreibt die lose Erde zwischen Daumen und Zeigefinger und führt sie an die Nase. „Mangelnde Durchlüftung verlängert den Verwesungsprozess.“ Corinna steht hinter ihm. „Und das führt zur Verunreinigung des Grundwassers, wussten Sie das?“ Sie will den Revolver ziehen. Die Situation ist günstig. Etwas hält sie zurück. „Die meisten wissen es nicht, und ich wette, dass es so mancher Friedhofsgärtner nicht weiß.“ Erst die anderen, und dann der Mann, der dich zu den anderen führt. Sie sagt: „Ich muss telefonieren.“ Sie entfernt sich, bis sie außer Hörweite ist und tippt die Nummer ein. „Mutter, ich habe den Koch. Er macht scharfe Senfsoßen und mag Friedhöfe, aber am meisten mag er das Meer.“
„Hast du ihn erledigt?“
„Er ist anders.“
Sie hört die Mutter schwer atmen. „Du erledigst ihn, hörst du, und tu es gründlich.“
„Er kann mich zu den anderen führen.“
„Dann mach ihm Angst, hörst du, er braucht Angst um sein Leben, und dann wird er reden.“
„Ich glaube nicht, dass er sich viel aus seinem Leben macht.“ Corinna hört, wie die Mutter ein Streichholz entflammt. „Und aus unserem Leben, was hat er daraus gemacht?“ Die Mutter inhaliert. Corinna sieht sie vor sich, in der Küche am Esstisch, den Aschenbecher in Reichweite, im Rücken Herd und Boiler, jenseits des Tisches die Balkontür, die zum Hinterhof rausgeht, in dem die Mülltonnen stehen. „Er hat einen Peter erwähnt.“
„Ich bin schlecht mit Namen, aber da war einer, vielleicht, dass er Peter hieß, und der war wirklich anders. Hat Geld gehabt, ein schönes Haus in Hamburg, und eine Nazifamilie.“
„Der Mann war ein Rechtsradikaler?“
„Das waren sie alle, es war modern, aber dieser Mann war politisch.“
„Und du?“
„Ich war ein Kind.“
„Was ist es, dass du dich nicht an die Namen erinnerst?“
„Es tut weh.“
„Wie willst du dich von etwas befreien, an das du dich nicht erinnerst?“
„Manchmal, da weiß ich sie ja.“
„Schreib sie auf.“
„Versuch ich, aber sobald ich es versuche, sind sie weg oder woanders. Ich gehe jetzt trainieren.“
„Du bist wieder am Trainieren?“
„Wir brauchen Kraft, meine Liebe, wir sind im Krieg. Ich bin seit sechs Monaten dran.“ Corinna stellt sich das schmerzverzerrte Gesicht beim Stemmen der Hanteln vor, die Entschlossenheit, wenn die Mutter das nächste Gewicht auf die Stange schiebt. „Zum Henker mit der Liebe, Mutter.“
„Red nicht so mit mir, meine süße Liebe, ich bin deine Mutter.“
„Klara, das ist deine Liebe.“ Es kommt aus ihr raus wie alles andere. Sie hat es nicht kommen sehen.
„Lass deine Schwester aus dem Spiel, hörst du?!“
„Und du, sprich du nicht von Liebe.“
„Kann jeder zu sagen, wie er will, aber lass deine Schwester aus dem Spiel, hörst du?!“
„Danke für die Patronen.“ Ein Glas fällt um, die Mutter stellt es wieder auf. „Mutter? Pass auf dich auf, und wenn du dein Phäschen hast, dann nimm die Tabletten.“ Neun Jahre, dass Klara tot ist. Neun Jahre, dass sich bei der Mutter Depression und Manie abwechseln. Neun Jahre, dass sie dazu Phäschen sagen. Corinna legt auf. Eine Manie ohne Tabletten, die ist gefährlich. Sie vergewissert sich, dass die Revolvertrommel bestückt ist. Sie sieht über die Schulter zu Schleyer hin, der mit dem Rücken zu ihr dasteht. Sie tritt mit gezogener Waffe von hinten an ihn heran. „Wissen Sie“, sagt Schleyer, ohne dass er sich zu ihr umdreht, „auf dem Boot ist es wie im Krieg.“ Sie zielt auf seinen Nacken. „Man hält zusammen, ob man will oder nicht, weil man zusammenhalten muss, und um die Sache erträglich zu machen, nennt man es Freundschaft.“
Sie steckt die Waffe weg. „Interessant.“
„Für die Humanbiologin?“ Sie antwortet nicht. „Es ist eine böse Freundschaft, Frau Humanbiologin, in einer bösen Welt, einer Welt, die zusammenschweißt, was nicht zusammengehört.“ Er dreht sich zu ihr um. „Was macht eine Frau wie Sie mit einer Waffe?“ Sie spürt das Adrenalin, das ihr in den Kopf schießt. „Sie hatten im Radieschen einen Revolver in Ihrer Handtasche. Sailor hat ihn gefunden und glaubt, dass ich es nicht mitbekommen habe.“ Corinna starrt den Mann an. „Radieschen“, sagt der Mann, „das Lokal, in dem Sie sich heute begegnet sind?“
„Er hat meine Handtasche durchsucht?!“ Du musst Zeit gewinnen, jetzt, sofort.
„Als Sie auf der Toilette waren. Er hat die Patronen entfernt.“
„Er hat sich an meinen Sachen zu schaffen gemacht?!“
„Es fällt mir schwer zu glauben, dass Sie ihm so etwas nicht zugetraut hätten.“
Sie hört das Rauschen ihres Blutes, bewegt den Kopf, das Blut bewegt sich mit, das Rauschen verdichtet sich, löst sich auf, kommt wieder, dann steht da ein Satz: Dieser Mann geht davon aus, dass der Revolver nicht geladen ist, du bist den Schritt voraus.
„Ist alles in Ordnung mit Ihnen?“
„Die Waffe ist ein Familienstück und eher was für Karnickel.“
„Sie sollten trotzdem vorsichtig sein mit so etwas.“
„Mit so etwas, ja genau.“ Das Rauschen ist weg oder woanders, die Gedanken sind wieder klar. Der Mann rät dir zur Vorsicht, und das tut keiner, der sich bedroht fühlt. Ihre Hand steckt in der Tasche und hält die Waffe. „Fühlen Sie sich bedroht?“
„Sollte ich?“
„Ach.“ Sie fällt in einen Zustand der Erschöpfung. Sie spürt den Alkohol und will mehr davon. Ihr Blick wird glasig. „Er hat mich gepimpert, und wo ist er jetzt hin?“ Erst das hier, und dann kannst du dich volllaufen lassen. „Und Sie?“ Sie überkommt das Bedürfnis, den Mann zu verletzen. „Sind wohl einer, der mit dem Kopf denkt?“
„Ich kann auch anders“, sagt Schleyer, ohne dass es bösartig klingt.
„Und die anderen?“
„Können nur anders.“ Er deutet auf die Handtasche. „Seien Sie vorsichtig. Mit der Waffe und mit Männern wie Sailor.“
„Ich studiere den Mann an sich. Und das Verhältnis der Männer untereinander.“
Sein Lächeln wirkt aufgesetzt. „Den Mann an sich.“ Er hört auf zu lächeln. „Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen das abnehme?“
„Ich wollte Ihren Freund studieren, und dann hat sich etwas anderes ergeben, ja warum denn nicht, er ist doch Ihr Freund?“ Pass auf, was du sagst, hörst du, und pass auf, wie du es sagst, genau, sag, was du willst, aber sag es so, dass er es dir abnimmt. „Vielleicht, dass Sie sich doch bedroht fühlen?“
„Ja wie hätten Sie es denn gerne?“
„Ein Mann, der sich von einer Frau bedroht fühlt.“
„Da müssen sie schon mehr auffahren.“ Er setzt sich auf die Mauer, die die Kirche umgibt. „Sie wollen uns verstehen?“ Corinna setzt sich neben ihn und hält einen Meter Abstand. „Los jetzt, erzählen Sie. Von der Schutztruppe und Dingen, die man ungeschehen machen will.“ Schleyer greift nach seiner Hand und massiert die Narbe. „Weihnachten 1973. Wir haben ein Geschäft aufgezogen und waren zu jung, um zu begreifen, wie so etwas läuft.“
Читать дальше