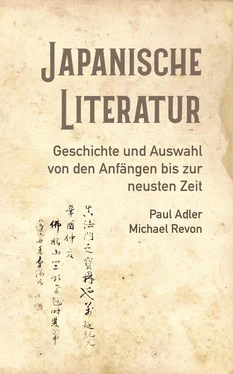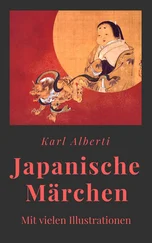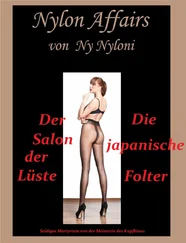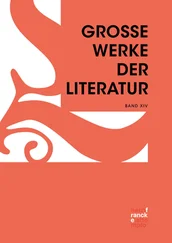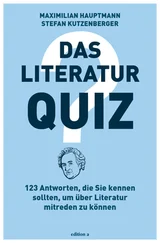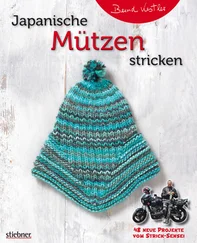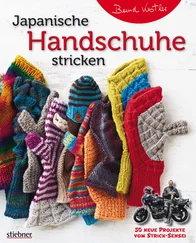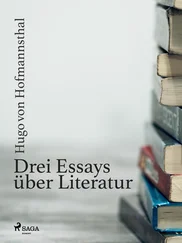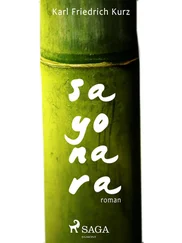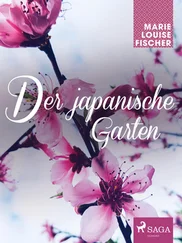Michael Revon - Japanische Literatur
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Revon - Japanische Literatur» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Japanische Literatur
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Japanische Literatur: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Japanische Literatur»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Japanische Literatur — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Japanische Literatur», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Sein dreimalgewundenes Tau schlang er darum, zog ganz leise (wie an frostschwarzer Tsusurafruchtwolle). Still zog er daran, wie ein Kahnzieher am Fluß: »Komm du, Land! Komm du, Land!«
Das also angeheftete Land liegt zwischen der Endspitze Kodsu und der Landspitze Kidsuki, der achtmal gebauten. Der Ankerpfahl ist der hohe Sahime an der Gemarkung der Gaue Ihami und Idsumo. Das Tau aber ist der Leinpfad von Sono.
Danach tat er sich noch gen Sakiland um, an dem Nordens-Tor, nach noch weiterem Land-Rest. »Hier ist auch ein Übriges.« Und: »Komm du, Land!« – Der also gezogene und geheftete Gau ist Sada von der Endspitze Taku an. So tat er sich noch um gen Sunamiland an dem Nordens-Tor, nach noch weiterem Land. »Hier ist auch ein Übriges.« Und: »Komm du, Land!« Das also gezogene und geheftete Land ist der Kuramigau von der Endspitze Taguhi an. So tat er sich noch nach der Landspitze Tsutsu um nach noch weiterem Land. »Hier ist auch ein Übriges.« Und: »Komm du, Land!« – Das also gezogene und geheftete Land ist der Mihofels. Das Tau, daran es gezogen ward, aber bildet die Yomi-Insel. Der Pfahl ist der Okari im Hahakigau.
»Nun aber genug gezogen an Land!« Sprach's. Und wie er im O-u-Forste seinen Götterstab niederlegt', atmet' er laut: »O-u«. Danach heißt der Gau O-u.
Die Versdichtung der Nara-Zeit
Japans klassische Dichtung ist von der modernen europäischen Dichtung wesentlich verschieden. Unsere umfangreichen epischen und dramatischen Formen sind nicht vorhanden. Vorhanden ist vorzugsweise die Lyrik. Der japanische Dichter verzeichnet so wie der japanische Maler mit einigen kraftvollen oder zarten Pinselstrichen einen Eindruck, die Regung seines Herzens oder sein Entzücken vor der Natur. Der japanische Dichter dichtet im vollen Bewusstsein seiner Kunst sowohl als der Grenzen seiner Begeisterung.
Dies erklärt leicht die Kürze fast aller japanischen Gedichte. Der klassische Typus der höfischen Dichtung ist das »Kurzgedicht« (Mijika-uta, Tanka), eine Strophe von fünf Versen von abwechselnd fünf und sieben, zuletzt jedesmal wiederum sieben Silben. Auch die Langgedichte (Naga-uta, Choka) sind in demselben wechselnden Silbenmaß geschrieben und nicht allzu lang. Trotzdem wurde auch diese Form fallen gelassen, die Tanka später, in der Tokugawa-Zeit, durch den bloßen Dreizeiler ersetzt. Aber in diesen Formen weiß der Japaner doch sehr vieles auszudrücken. Der Reim und Silbenwert werden ersetzt durch den natürlichen reinen Klang der Sprache, aus der für die Dichtung jedes chinesische Wort ausgeschlossen bleibt. Auf diesem zarten Instrument spielt der Dichter liebevoll in geistreichen Wortspielen, die oft den Hauptteil seiner höfischen Kunst ausmachen. Besonders drei Arten solcher Koloraturen der Lyrik müssen für jedes Verständnis erwähnt werden: Das sogenannte »Kissenwort« (makura-kotoba), ein Epitheton ornans, das oft den ganzen ersten Vers erfüllt, mitunter – in der vorklassischen Zeit – sich zum Gedicht selbst erweitert und eine ferne, geheiligte Vorstellung erweckt. Von solchen Kissenworten findet man in den hier mitgeteilten Gedichten sehr viele, aber eine große Anzahl auch in der Prosa, so zum Beispiel in dem »Idsumo-Grundriss« und der weiter unten gegebenen »Vorrede zum ›Kokinshu‹«. Der Sinn all dieser Beiworte war dem primitiven Japaner natürlich; einige entsprechen übrigens den homerischen. Allmählich aber wurden sie mehr oder minder feierlich und geheimnisvoll, eine Art Thema der auf sie aufgebauten Gedichte. Daher der befremdliche Name. Eine weitere Spielform ist die »Introduktion« (Jo), durch welche die ersten drei Verse der Tanka mit ihrem Abgesang durch ein leichtes Wortspiel verbunden werden, wodurch der ganze erste Dreizeiler wieder zu einer Art »Kissenwort« des Schlusses wird. Endlich verwendet der japanische Dichter sehr häufig das Doppelsinnige Wort (kenyogen), von den europäischen Japanologen Pivôt genannt; oder auch nur eine doppelsinnige Silbe, die wie eine ›Türangel‹ alles Nachfolgende mit dem Vorhergehenden verbindet. Hat man ihr diese spielenden Eigenschaften einmal zugestanden, so wird die japanische Dichtkunst außerordentlich reizvoll, eine wundervolle Vereinigung lyrischen Schwungs und strenger Gesetze. Sie gibt sozusagen ziselierte Eindrücke, die freilich durch allzu sorgfältige Ausführung auch oft den Inhalt unter dem äußeren Glanz verschwinden lassen. Bei allem muß jedoch ein bislang noch gänzlich unaufgeklärter Zusammenhang mit Gruß- und Spottliedern und mit primitiv-religiöser Rhythmik angenommen werden, dessen Feststellung und Aufhellung zu den auch sonst zahlreichen Aufgaben einer noch nicht bestehenden ethnologischen Japandurchforschung gehört.
So kurze Kunstformen können natürlich nicht leicht einen Gedichtband ausmachen. Vielleicht auch darum vereinigte man von Anbeginn die Gedichte mehrerer Dichter zu Anthologien. Die Japaner betrachteten auch immer, und nicht mit Unrecht, die Dichtkunst ihrer Dichter als das Erzeugnis einer bestimmten Epoche. Der Kaiserhof ließ von Zeit zu Zeit die besten Gedichte der letztvergangenen Zeiten zu den uns erhaltenen und in unserem Buche auszugsweise übertragenen Sammlungen veranstalten.
Das Manyoshu
Die Dichtkunst der Nara-Zeit ist gesammelt in dem »Zehntausendblatt« Manyoshu. Der genaue Sinn dieses Titels steht freilich nicht fest. Yo bedeutet ein Pflanzenblatt und ebenso ein Alter, eine Epoche, so daß das Wort »Sammlung« auch »Sammlung aus Zehntausend Epochen«, d. h. der bisher vergangenen Herrscherzeiten, bezeichnen kann. Revon selbst faßt »Yo« im Sinne von »Gesprochenen (beschriebenen) Blättern« auf, gemäß der Einleitung des »Kokinshu«. Die Sammlung ist erst zu Beginn des neunten Jahrhunderts zusammengestellt, wahrscheinlich von Yakamochi aus dessen und anderer Dichter Haussammlungen. Die meisten Stücke sind aber 300 bis 350 Jahre älter. Unter diesen sind 4173 Langgedichte, 262 Kurzgedichte und 61 sogenannte Sedoka (Refraindichtungen, dem Ursprunge nach Wechselgesänge). Sämtliche Gedichte sind in chinesischen Schriftzeichen geschrieben, die zum Teil Bildcharakter, zum Teil aber bereits phonetisch und mitunter sehr verwickelt gebraucht werden. Die zahlreichen einheimischen Erklärer aller Zeiten haben aber den Sinn der Manyoshu-Gedichte auf ihre Art festgestellt. An künstlerischemWert, an unmittelbarer Lebensfrische und Gefühlsstärke übertrifft das, übrigens stark von der gleichzeitigen chinesischen Tang-Dichtung beeinflußte, Manyoshu alle späteren Sammlungen.
Unter seinen einzelnen Dichtern stellen die Japaner die »Fünf großen Männer des Manyo« am höchsten. Es sind dies : Hitomaro, vom Ende des siebenten Jahrhunderts mit dem Vollnamen Kakinomoto no Hitamaro, eine in ihrem Leben legendäre Persönlichkeit. Ein Krieger findet am Fuße eines Baumes ein Kind von überirdischer Schönheit. Es wird ihm offenbart, daß es »ohne Vater noch Mutter geboren, als ein Dichter der Sonne, dem Mond und den Winden gebieten« würde. Nach dem Baume Kaki benennt der Finder das Kind Kakinomoto. Für die Forschung steht nur fest, daß das Geschlecht Hitomaros sich eines kaiserlichen Ursprungs rühmte, und daß der Dichter unter der Kaiserin Jito und dem Kaiser Mommu irgendwelche Ämter bekleidete. Er begleitete dann den Prinzen Nihitabe auf mehreren Reisen, die er alle in Tankas besang. Sein (jedenfalls unechtes) Grabmal wird noch heute in einem Dorfe in Yamato gezeigt.
Der zweite (Hauptdichter der Sammlung und) »Weise der Dichtkunst« (Uta no hijiri) ist Yamabe no Akahito. Yamabe war der Name einer erblichen Kaste von Waldhütern. Wie Hitomaro so bereiste auch Akahito die Provinzen, um 725 in Begleitung des Kaisers Shomu den Osten. Einige Zeit später schrieb er das berühmte (unten übertragene) Gedicht »Auf den Fuji« (yama). Beide Dichter zusammen nannten die alten Japaner kurz den »Yama-Kaki«.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Japanische Literatur»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Japanische Literatur» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Japanische Literatur» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.