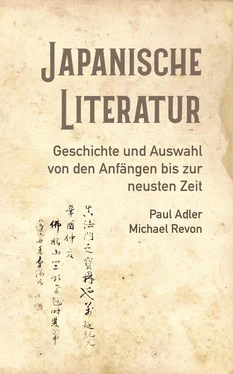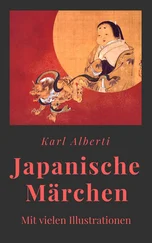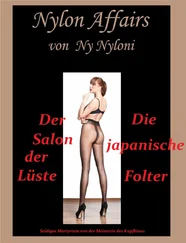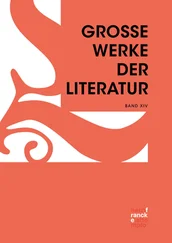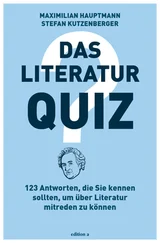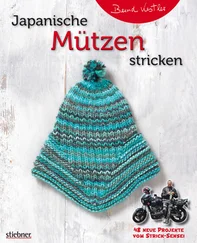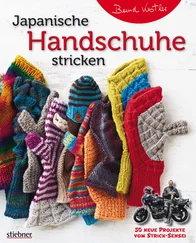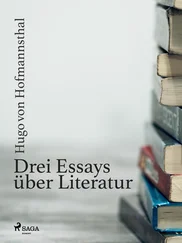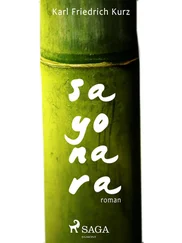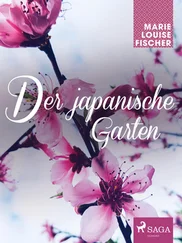Michael Revon - Japanische Literatur
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Revon - Japanische Literatur» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Japanische Literatur
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Japanische Literatur: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Japanische Literatur»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Japanische Literatur — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Japanische Literatur», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Paul Adler, Michael Revon
Japanische Literatur
Geschichte und Auswahl von den Anfängen bis zur neusten Zeit
Erstmals erschienen 1926
© Lunata Berlin 2019
Inhalt
Zur Einführung
Urzeit
Nara-Zeit
Die Versdichtung der Nara-Zeit
Heian-Zeit
Kamakura-Zeit
Nambokuchozeit und Muromachizeit
Die Tokugawa-Zeit
Die Meiji-Ära seit 1867
Autorenverzeichnis
Über die Autoren
Inhalt
Zur Einführung
Urzeit
Nara-Zeit
Die Versdichtung der Nara-Zeit
Heian-Zeit
Kamakura-Zeit
Nambokuchozeit und Muromachizeit
Die Tokugawa-Zeit
Die Meiji-Ära seit 1867
Autorenverzeichnis
Über die Autoren
Zur Einführung
Das japanische Schrifttum – das hier zum erstenmal in Deutschland in einem Überblick vorgelegt wird – will von dem Leser nicht anders wahrgenommen werden, als etwa eine Abteilung ostasiatischer Flora in einem groß angelegten botanischen Garten. Wie dort der Gärtner, so hatte hier die Übertragung ein Zweifaches anzustreben: ästhetischen Genuss neben der bloßen Belehrung. Es liegt auf der Hand, daß diese beiden Aufgaben an einem so exotischen Gegenstand nicht immer gleichzeitig zu erfüllen waren.
Das Japan, das man in diesem Bande kennen lernt, ist nicht die einseitig graziöse impressionistische Kunstprovinz der Keramik und der Lackarbeiten, noch weniger das europäisierte und industrialisierte Land unserer Gegenwart. Aber auch nicht allein das ritterliche, strenge Feudalland von gestern oder das in unsere Zeit fremdartig hineinragende Reich eines, an den alten Orient und an Afrikanisches gemahnenden, Gottkaisertums. Man wird kein bloßes Brevier adeliger Hofkunst vorfinden und auch keine Art buddhistischen Breviers. Die japanische Literatur umfaßt vielmehr, als Spiegel einer mehr als tausendjährigen Geistesgeschichte und Beeinflussung von ältesten Kulturen her, alles das – und in Wahrheit noch etliches mehr und viel Tieferes. Ohne eine gewisse fortlaufende Beachtung der kulturellen und auch der sogenannt politischen Erscheinungen in ihren Grundzügen kann die so abgelegene japanische Dichtung und Prosa gar nicht aufgefaßt werden.
Die älteste schriftlose, nur mittelbar überlieferte Urzeit und die wichtigen religiösen Dokumente der, nach der ersten dauernden Kulturstätte Nara benannten, Epoche (8. Jahrhundert) zeigen ein Volk von Fischern und Jägern, das gerade den Reisbau, jedenfalls vom Festlande her, eingeführt und geregelt hat. Aber dieses Volk ist, wie die meisten werdenden Kulturvölker, nicht mehr homogen. Die hellere Urbevölkerung der Ainu (Emishi) ist von Festländern gründlich und von seewärts einbrechenden malaiischen Herrenstämmen oder Seeräubern politisch durchsetzt worden. Das »Kojiki«, der nach Jahrhunderten redigierte Niederschlag der Anschauungen dieser letzten Einwanderer, zeigt die den polynesischen Vettern verwandte Götter- und Kulturheroenwelt in ihrer teils kriegerischen, teils friedlichen Auseinandersetzung mit den »Landesgöttern«, d. i. den Autochthonen. Dieses, japanisch nur lesbare, weil von der schriftlosen jungen Nation in chinesischer Bilderschrift niedergeschriebene Geschichtswerk vom Beginn des 8. Jahrhunderts hat freilich, gleich seinem rein chinesischen Parallelwerk, dem »Nihongi«, die wichtigen innern Kämpfe zwischen den einzelnen Erobererstämmen vertuscht. Sie sind da und dort noch erkennbar; ganz charakteristisch in dem Streit von Sonne (Amaterasu) und Wind- und Unterweltsgott Susanowo um ihre Nachkommenschaft, d. i. um die Vorherrschaft auf den »Acht Inseln«. Jimmu-Tenno, der Häuptling der südlichen Insel Kiushu, der Sonnenspross – ein Priester nach unserer modernen Auffassung – überschattet erst im Laufe von Jahrhunderten die andern Stämme (jap. Uji), seine Nachkommen überwältigen auch die Nachkommen Susanowos mit der Tochter des »Herrn vom Großen Berge«, des Gottes Fuji. Doch das im Kojiki so fertig aussehende, von uns so genannte Mikadotum ist darum noch lange nicht vollendet. So etwa wie der Horus-Falke in Ober- und Niederägypten, Gau um Gau, muß sich der »Himmelsenkel« von Kyushu auf der Hauptinsel Hondo, vom aufgesogenen Yamato östlich und nördlich vordringend, bei den andern Göttersprossen durchsetzen. Diese Art von Bundesverfassung lokaler Stammgottheiten weicht erst im 7. Jahrhundert dem in China schon seit langem orthodox gewordenen Königsprinzip der zentralen Beamtenverwaltung. Das geschieht durch die sogenannte Taikwa (Reform), wodurch, nach längerem vorbereitenden Einfluß von Korea, die chinesische Hierarchie der »Mützenränge« eingeführt wird, und durch die im wesentlichen bis zur Revolution von 1867 maßgebende Codification der Aera Taiho (um 700 n. Chr.). Der Literaturgeschichte hat diese frühmittelalterliche Zeit neben den mehr chinesischen Staatsdokumenten die Niederschriften der weit älteren Shinto-Riten hinterlassen als das kostbarste und großartigste Erzeugnis des alten Japan. Wie so oft, ist auch hier das Archaische von nicht wieder erreichter Schönheit. Die Wirkung, die sich aus seinem noch magischen und geglaubten Inhalt von selbst ergibt, übertrifft psycho-physisch alle später erstrebte Wirkung auf Sinne oder Gemüt.
Die Gedichte (gesammelt im 9. Jahrhundert zu dem, sprachlich in ihrer Niederschrift bald unverständlich gewordenen, Manyoshu) sind demgegenüber bereits bewußte Erzeugnisse. Am nächsten der alten Zauberwelt freier Rhythmen stehen die Hymnen oder Oden Hitomaros, eines orphischen Pindar, und die Verse des gleich nationalen Akahito. Die ungefähren Zeitgenossen: Okura, Tahibito und dessen Sohn Yakamochi sind bei aller großartigen geistigen Fortgeschrittenheit, besonders des Okura – stark im Banne der chinesischen Tang-Dichtung. Nicht solcher Stimmungsbilder, wie sie alle Welt von Li-Tai-Po kennt, sondern der zugleich weit ausladenden und realistisch eindringenden Dichtung etwa eines Tu-Fu. Um jene Zeit ist Japan bereits eine geistige Provinz Chinas, dessen imponierende, in den Staatseinrichtungen und einer klassisch-kanonischen Literatur niedergelegte Weisheit es jedoch in engster Verbindung mit einem schon lange chinesisch gewordenen Buddhismus erhält. Japan wird etwa 300 Jahre später als China von dem Licht des Ostens erleuchtet und tiefer durchleuchtet als dieses Durchgangsland der buddhistischen Patriarchen. Auf dem »Großen Fahrzeuge«, der weit mehr als alle katholische Kirchenpolitik aller Zeiten dem Polytheismus entgegenkommenden »Mahayana«-Richtung des nördlichen Buddhismus, flüchten Japans alte Götter (die Kami) in den Kern des alleinseligmachenden Lotus, von wo sie auch durch die spätesten neukonfuzianischen und nationalen Reinigungen nicht wieder zu entfernen sind. Der, mehr oder minder weltflüchtige, mehr oder minder gelehrte Mönch wird die wichtigste geistlich-geistige Erscheinung im fernen Osten ebenso wie ungefähr gleichzeitig im fernsten Westen auf der »Grünen Insel«. Und nahezu in demselben Jahre wie Monte Cassino kommt Boddhidharma, der Gründer der Meditationssekte Chinas, der späteren Zensekte Japans, in das Land des Tao. Seine Mission vollbringt dann, in Fortsetzung der theologischen Tendai-Richtung, das Butsudo, die geistige Umwandlung des malaiischen Recken in den buddhistischen japanischen Ritter. Ein Bernhard von Clairvaux hat ähnlich den Adel Frankreichs mit Mystik getränkt. Man lese dazu die Proben aus dem Heike-Monogatari und dem Gempei Seisuiki.
Doch Buddha war, wie gesagt, zugleich mit den chinesischen Klassikern eingezogen. Wem das unvorstellbar ist, der denke zum Beispiel an die gemeinsame Wirkung des weltlichen und des christlichen Rom auf die jungen Völker Nordeuropas und, noch nach Jahrhunderten, die Entwicklung der »beiden« römischen Rechte oder die aristotelische Thomistik.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Japanische Literatur»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Japanische Literatur» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Japanische Literatur» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.