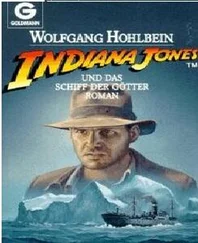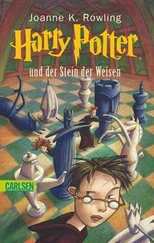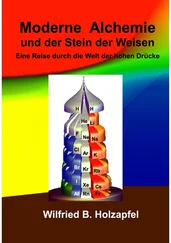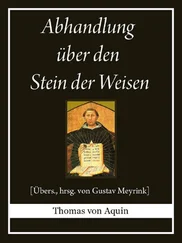»Und dann?«
»Keinen Schimmer«, murmelte Indy unter dem Hut hervor. »Eventuell ist mir bis dann was eingefallen.«
»Wann immer du anfängst, dir was einfallen zu lassen, mache ich mir Sorgen«, sagte Alecia. »Du denkst zuviel nach. Es ist in gewisser Hinsicht gerade so, als fordere man das Schicksal heraus. Genau wie beim Wünschen. Als kleines Mädchen wünschte ich mir niemals etwas zu sehr, weil ich Angst hatte, daß es dann nicht in Erfüllung geht. Solange ich nicht darüber nachdachte, konnte ich nicht allzu sehr enttäuscht werden. Mit dieser Einstellung verläuft das Leben in geordneten Bahnen. Keine Höhen und Tiefen.« Sie blickte zu Indy hinüber. »Jones?« fragte sie.
Dann nahm sie das Fernglas in die Hand und beobachtete wieder das Lager. Nichts rührte sich. Selbst die Hunde, die vorhin auf der anderen Seite des Zaunes Wache gehalten hatten, schliefen mittlerweile.
»Wie kannst du in solch einem Augenblick schlafen?« fragte sie. »Du hast Nerven, mein Lieber. Ich bin ganz aufgeregt, komme mir wie eine Feder vor, die jeden Moment hochschnellt.« Sie legte das Fernglas wieder weg.
»Alistair ist genau das Gegenteil«, fuhr sie fort. »Er wünschte sich andauernd etwas. Und schrie und zog eine Schnute und hielt den Atem an, wenn er es nicht kriegte. Es war gerade so, als würde er das Wünschen für uns beide übernehmen. Manchmal funktionierte es sogar. Und nun habe ich das Gefühl, meine andere Hälfte verloren zu haben.« Alecia bettete den Kopf auf die Arme.
»Diese Stunde der Nacht, irgendwann vor dem Morgengrauen, mochte ich schon immer ganz besonders«, sprach sie weiter. »Als kleines Mädchen blieb ich die ganze Nacht lang wach, nur weil ich wußte, daß alle anderen schliefen und mich nicht stören würden. Mit Ausnahme von Alistair, natürlich. Er wachte immer so um die se Uhrzeit in der Nacht auf und stolperte auf die Toilette und ließ die blö-de Tür offen, weil er nicht wußte, daß ich wach war. Das konnte ich auf den Tod nicht ausstehen. Ich legte die Hände auf die Ohren, bis er fertig war, zählte die Sekunden, bis er das Licht ausschaltete und ins Bett zurückkehrte.«
Alecia drehte sich auf die Seite und sah Indy beim Schlafen zu.
»So gefällst du mir irgendwie«, sagte sie. »Du siehst ganz gut aus, weißt du das, Jones? Bist im Moment ein bißchen wortkarg, aber wenigstens widersprichst du mir dann nicht.«
»Was hältst du für die am wenigsten bewachte Stelle im Lager«, fragte er sie.
»Du bist wach!«
»Ist schwer zu schlafen, wenn jemand die ganze Zeit über neben dir brabbelt. Aber nun mal zur Sache: Wenn du Wache wärst, welche Stelle würdest du auslassen? Welche Stelle wäre dir unangenehm? Du weißt schon, ein Fleckchen, wo du so schnell wie möglich vorbeigehst, ein Ort, von dem du nicht glaubst, daß er den Feind interessiert. Vielleicht eine Stelle, die selbst die Hunde vernachlässigen.«
»Die Latrine«, sagte sie.
»Ja. Steht Alistair immer noch um diese Uhrzeit auf, um aufs Klo zu gehen?« wollte er von ihr erfahren.
»Gut möglich«, sagte sie. »Ich weiß es wirklich nicht. Ist lange her, seit ich die ganze Nacht aufblieb. Das habe ich nicht mehr getan, seit wir uns kennengelernt haben. Und außerdem haben wir jetzt andere Zimmer als früher, als wir Kinder waren. Ich denke nicht, daß es mir auffallen würde, falls er diese Gewohnheit beibehalten hat.«
Alecia schaute ein letztes Mal durchs Fernglas.
»Aber es ist einen Versuch wert«, fand sie. »Ich meine, wir können ja schließlich nicht mitten in der Nacht an jede Tür klopfen, bis wir ihn endlich finden. Möglicherweise wäre es tatsächlich klüger, ihn zu uns kommen zu lassen.«
»Alecia, du gehst da nicht runter.«
»Wieso nicht?«
»Das ist ein Ein-Mann-Job«, sagte er.
»Vielleicht ist es aber ein Eine-Frau-Job«, entgegnete sie.
»Ich fürchte, dort unten gibt es keine Schwerter«, sagte er. Er verstaute sein Feldnotizbuch in einer Tasche, die ins Futter seiner Lederjacke genäht war. »Es ist sinnvoller, daß ich gehe. Bitte, argumentiere jetzt nicht, sonst mache ich auf dem Absatz kehrt und haue ab.«
Alecia schwieg.
»Das werte ich als Zustimmung«, sagte er und zog den Reißverschluß der Lederjacke hoch. Mit großer Geste nahm er den Fedora ab, inspizierte den Rand und setzte ihn ihr auf.
»Paß auf ihn auf«, sagte er. »Ich werde zurückkommen, um ihn zu holen. Falls ich bei Morgengrauen nicht zurück bin - oder falls du Schüsse hörst -, verschwindest du so schnell es geht. Bleib nicht hier, denn du wirst nicht in der Lage sein, Alistair oder mir zu helfen, ohne auch gefangengenommen zu werden.«
»Du hast genug Wasser für drei Tage«, fuhr er fort. »Und ich lasse dir die Webley hier - Marlow hat sie gereinigt -und eine Schachtel Patronen. In diesem Teil der Welt behandeln sie Frauen nicht sonderlich nett, also scheu dich nicht, die Waffe auch zu benutzen. Im Notfall wäre es das beste, wenn du die Küste entlang Richtung Westen gehst. Wenn du in die Zivilisation zurückkehrst, setz dich bitte mit Marcus Brody am American Museum of Natural Histo-ry in Verbindung. Einverstanden?«
Alecia nickte.
»Morgendämmerung«, sagte er und legte eine Pause ein. »Wie sieht Alistair aus?«
»Stell dir mich als Mann vor«, sagte sie. »Mit kurzgestutztem Bart.«
Indy verstaute die Drahtschere aus dem Rucksack in seiner Hosentasche und stapfte die Düne hinunter. Alecia beobachtete ihn durch das Fernglas. Er bewegte sich mit eingezogenem Kopf fort, hielt sich hinter den Dünenerhebungen und aufragenden Felsen und arbeitete sich zur anderen Seite des Lagers vor.
Alecia verlor ihn aus dem Blickfeld.
Die letzten hundert Meter zum Stacheldrahtzaun robbte er auf Ellbogen und Knien weiter, die Wachtürme an den Ecken nicht aus den Augen lassend. Bei der ersten Drahtabzäunung vergewisserte er sich, daß die Hunde nicht in der Nähe lauerten, schnitt die unteren Drähte durch und krabbelte durch die Öffnung. Ein Drahtende fuhr ihm unterhalb des rechten Wangenknochens über das Gesicht und hinterließ einen langen, blutenden Schnitt. Innerlich aufstöhnend, tupfte er das Blut mit dem Ärmel seiner Jacke ab und krabbelte quer über den Hundepfad zum zweiten Zaun. Diesmal mußte er die Schere dreimal einsetzen, ehe er ins eigentliche Lager gelangte. Die Holzlatrine schützte ihn vor den potentiellen Blicken der Lagerbewohner.
»Stinkt mächtig«, murmelte er und hielt den Atem an. Er kroch um den Holzverschlag herum und rannte dann zur Tür. Drinnen war der Gestank noch unerträglicher und aufdringlicher als draußen. Der schwache Schein dreier, in regelmäßigen Abständen herunterbaumelnder Glühbirnen, die durch ein ausgefranstes Stromkabel miteinander verbunden waren, sorgte für Licht. Eine Holzbank nahm die ge -samte Rückwand der Latrine ein. Im Notfall bot sie zwölf Männern die Möglichkeit, sich zu erleichtern.
»Nicht gerade sehr privat«, kommentierte Indy.
Entlang der Wände waren Trichter zu erkennen, und in der Mitte stand eine Art Waschstation, die vom auf den Deckenverstrebungen ruhenden Tank mit Wasser gespeist wurde.
Indy wickelte seine Peitsche ab, holte aus, so gut es ging, bis sich die Spitze um den mittleren Balken wickelte. Daran zog er sich hoch. Nachdem er die Peitsche aufgewickelt und an den Gürtel gehängt hatte, krabbelte er zu dem Stromkabel hinüber. Er hielt die erste Glühbirne hoch, befeuchtete die Fingerspitzen mit Speichel gegen die Hitze und drehte die heiße Birne aus der Fassung. Ein Stück weiter vorn drehte er die zweite Glühbirne heraus. Diesmal verspürte er einen leichten Stromschlag, weil die schützende Kabelummantelung aufgebrochen war.
Nun brannte nur noch das letzte Licht im hinteren Latrinenwinkel.
Indy machte es sich auf dem Balken bequem, lehnte sich an einen aufstrebenden Pfosten und wartete. Zwanzig Minuten später schwang die Tür auf, was ihn in Alarmbereitschaft versetzte. Im fahlen Licht begab sich der Mann unter ihm zum Waschstand in der Mitte der Latrine, schlug mit dem Schienbein dagegen und begann, auf italienisch zu fluchen.
Читать дальше