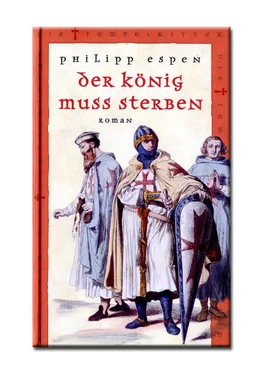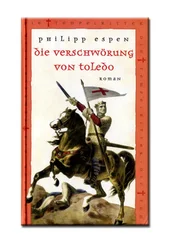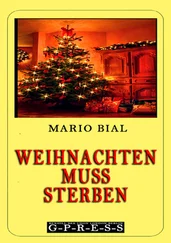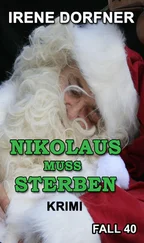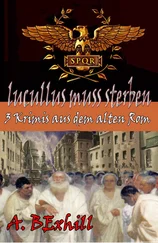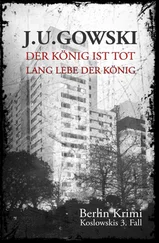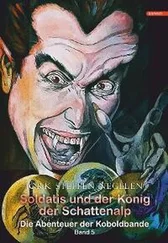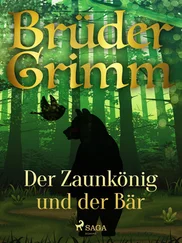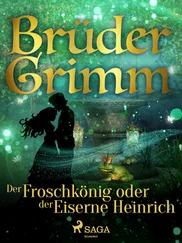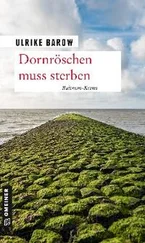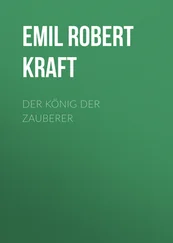Philipp Espen - Der König muss sterben
Здесь есть возможность читать онлайн «Philipp Espen - Der König muss sterben» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2003, Жанр: Исторические приключения, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der König muss sterben
- Автор:
- Жанр:
- Год:2003
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der König muss sterben: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der König muss sterben»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der König muss sterben — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der König muss sterben», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Unvorstellbar ist ein solcher Plan innerhalb des Ordens nicht. Immerhin waren die Tempelritter auch schon im Heiligen Land in einen Mordanschlag verwickelt gewesen. Als sich die Verhandlungen des Königs von Jerusalem mit dem Alten vom Berge, dem Kopf des muslimischen Assassinen-Ordens, für die Templer ungünstig zu entwickeln drohten, tötete ein Templer den Gesandten der Assassinen. Diese Episode zeigt deutlich, dass die Templer bei der Lösung solcher Probleme nicht zimperlich waren. Und wenn es um die Existenz des Ordens selbst ging, dann war sicherlich jedes Mittel recht. Allerdings ist bei dem vermuteten Mordkomplott gegen Philipp IV. zu bedenken, dass Hugues de Pairaud während des Prozesses gegen die Templer eine ganze Reihe ungeheuerlicher Verbrechen angelastet wurden. Immer wieder wurde er von den Zeugen bezichtigt. Und so wäre es auch nicht völlig auszuschließen, dass die Notiz nur ein weiterer weit hergeholter, aber plausibel erscheinender Anklagepunkt sein sollte, um gegen den Visitator vorzugehen.
Ziel der flüchtigen Tempelritter konnten letztendlich nur Gebiete sein, in denen der französische König keinen oder nur wenig Einfluss hatte. So bot sich zweifellos neben den englischen Besitzungen um Bordeaux auch das Herzogtum Bretagne als nahe gelegenes Rückzugsgebiet an. Imbert Blanc wurde in England verhaftet, wo er noch eine Rolle im dort gegen die Templer geführten Prozess spielen sollte.
Das Herzogtum Bretagne war als »Sprungbrett« nach England sicherlich ein in Frage kommendes Ziel in der ersten Zeit der Flucht. Auch existierte hier bis zur Auflösung des Ordens ein dichtes Netzwerk von Ordenshäusern und anderen Besitzungen und damit auch von Personen, die dem Orden verbunden waren. Schon seit dem Jahr 1141 waren die Templer in Nantes ansässig. In diesem Jahr hatte Herzog Conan III. von der Bretagne dem Orden in der Stadt einen Standort für ein Ordenshaus angewiesen, das er von der Gewalt der weltlichen Gerichte sowie von allen Abgaben freistellte. Darüber hinaus gewährte er dem Orden 100 Solidi jährlich aus den ihm zustehenden Einkünften der Stadt sowie Abgabenfreiheit im Bereich seiner Herrschaft für alle Güter im Besitz des Templerordens [Morice, I, Sp. 583]. Als Herzog Conan IV. die Privilegien des Ordens im Jahr 1160 bestätigte, nennt die zu diesem Zweck ausgestellte Urkunde fast 60 Orte, in denen sich Templerbesitz befand [Morice, I, Sp. 638; s. a. Havemann, 1846, S. 151, 152]. Wie eine weitere Urkunde aus dem Jahr 1222 zeigt, hatten die Templer zu diesem Zeitpunkt eine Burg in Nantes [Morice, I, Sp. 850; s. a. Havemann, 1846, S. 152]. Es war also ein sehr umfangreicher Besitz, der auch befestigte Plätze umfasste, der den Templern im Herzogtum Bretagne zur Verfügung stand.
Am Beginn des 13. Jahrhunderts war Peter Mauclerc, der dem französischen Königshaus entstammte, zum Herzog der Bretagne erhoben worden. Doch war er bestrebt, seine Herrschaft von Frankreich unabhängig zu halten, was ihn bis in den offenen Aufstand trieb. Er musste schließlich zugunsten seines Sohnes Johann I. abdanken, der in der Bretagne bis 1286 als Herzog herrschte. König Philipp IV von Frankreich erhob schließlich den nachfolgenden Herzog, Johann II. (1286-1305), in den Rang eines Pairs. Als Gegengabe für diese Rangaufwertung erwartete der König allerdings nicht nur die Huldigung durch den Herzog, sondern auch Unterstützung bei seinen militärischen Vorhaben sowie die Anerkennung der Oberhoheit des »Parlements« von Paris in rechtlichen Fragen. Der Herzog ging nicht wirklich auf die Ansprüche des Königs ein, sondern bemühte sich auf jede Weise, seine Stellung zu behaupten. Bei der aber dennoch vorhandenen engen Bindung an Frankreich kam es zu einer nachteiligen Entwicklung in der Bretagne. Viele bretonische Adelige sahen sich veranlasst, die angestammte Heimat zu verlassen. Sie bemühten sich um Ämter am Hof des französischen Königs oder beim Militär. Aber auch Gelehrte, Studenten und selbst Handwerker wanderten nach Frankreich ab, da sie sich dort bessere Verdienstmöglichkeiten versprachen. In der Bretagne selbst machte sich, besonders in der Sprache, französischer Einfluss breit.
Für den größten Teil der Angehörigen des Templerordens war die Vernichtung des Ordens nicht gleichbedeutend mit dem Tod. Während der Verhaftungswelle des Jahres 1308 war der allergrößte Teil der Ordensmitglieder zunächst eingekerkert worden. Ihr Unterhalt während der Haftzeit wurde aus Mitteln bestritten, die aus den Einkünften der beschlagnahmten Templergüter stammten. 18 Pfennige wurden für einen Ritterbruder aufgewandt, mit 9 Pfennigen musste ein dienender Bruder auskommen.
Die schließlich gefällten Urteile erstreckten sich vom Freispruch bis zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Zum Äußersten kam es allerdings nur in Frankreich, fielen dort doch zahlreiche Templer der Todesstrafe zum Opfer. Dieses harte Urteil traf diejenigen, die von ihrem einmal gemachten Geständnis abrückten und dieses widerriefen. Die ersten Opfer dieser Praxis waren 54 Templer, die im Mai 1310 zum Scheiterhaufen verurteilt wurden. Dies war allein auf das Betreiben des Königs hin geschehen. Philipp IV. hatte einen ihm genehmen Mann auf den Stuhl des Erzbischofs von Sens berufen lassen, der auch für Paris zuständig war. Von einem eilig einberufenen Konzil wurden die Templer verurteilt, die zunächst im Jahr 1307 ein Geständnis abgelegt, dieses aber bei einer späteren Vernehmung widerriefen. Als das Urteil gefällt wurde, blieben sie standhaft: »Kein Einziger bekannte sich zu irgendeinem der Verbrechen, die ihnen zur Last gelegt worden waren. Im Gegenteil, sie stritten beharrlich ab und sagten weiterhin, sie würden ohne Grund und unrechtmäßig hingerichtet, was viele Leute feststellen konnten, nicht ohne große Bewunderung und ungeheures Erstaunen« [Fortsetzung der Chronik des Guillaume de Nangis, Bd. 1, S. 377-378]. Und so bestiegen sie am 12. Mai 1310 die Karren, mit denen sie in die Nähe der Porte Sainte-Antoine gebracht wurden, wo der Scheiterhaufen hergerichtet war, auf dem ihr Leben endete. Weitere Verbrennungen gab es in Senlis, Pont-de-l’Arche und Carcassone.
Wer zur Kerkerhaft verurteilt wurde, hatte ein schweres Los. Unter den harten Haftbedingungen, zum Teil waren die Gefangenen ständig angekettet, starben wohl einige auch der ehemals hochrangigen Templer. Dies war das Schicksal des Ordensmarschalls von Zypern, der 1316 oder 1317 starb, sowie wohl auch des Visitators von Frankreich, Hugues de Pairaud. Doch auch diese Haft konnte enden. So wurde im Jahr 1321 nach zwölf Jahren der Kaplan des Temple von Langres, Pons de Bures, entlassen.
Wer schließlich freigesprochen wurde, lebte nach dem Ende des Ordens von einer Pension in einem der früheren Templerhäuser. Die Mönchsgelübde bestanden weiter, was aber einzelne ehemalige Templer nicht daran hinderte zu heiraten.
Nach dem Tod der Ordensoberen des aufgehobenen Templerordens auf dem Scheiterhaufen in Paris war auch dem Papst und dem französischen König kein langes Leben mehr vergönnt. Auch sie starben noch im Jahr 1314.
Papst Clemens V. gilt als Papst von Gnaden des französischen Königs, aber die moderne Forschung sieht das differenzierter. Er war kränklich und schwach, und schließlich hat er resigniert die Übergriffe und Anmaßungen des französischen Königs mehr ertragen als geduldet, dagegen angegangen ist er nicht.
Clemens V. war der Nachfolger des Papstes Benedikt XL, der für wenige Monate auf Bonifaz VIII. gefolgt war. Bonifaz VIII. hatte lange im Streit mit dem französischen König gelegen, weil Philipp den Klerus besteuern wollte. Der Papst hingegen wollte die Vorherrschaft der Kirche über die weltliche Herrschaft sichern.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der König muss sterben»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der König muss sterben» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der König muss sterben» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.