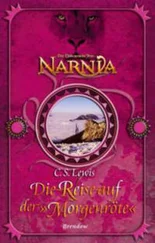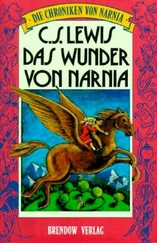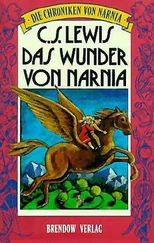Da er sehr müde war, nichts im Magen hatte und weil er sich überhaupt keinen Rat mehr wußte, liefen ihm auf einmal die Tränen über die Wangen hinunter.
Doch dann geschah etwas, was seine Aufmerksamkeit voll in Anspruch nahm. Shasta bekam plötzlich einen furchtbaren Schreck. Er merkte, daß irgend jemand oder irgend etwas neben ihm herging. Es war stockdunkel, und er konnte nichts sehen. Und das Tier oder die Person ging so leise, daß er kaum die Schritte hören konnte. Aber er hörte, daß da etwas atmete. Ja, dieser unsichtbare Begleiter machte so tiefe Atemzüge, daß Shasta den Eindruck bekam, es müsse sich um ein großes Tier handeln. Und da ihm dieser Umstand erst so nach und nach aufgefallen war, hatte er keine Ahnung, wie lange die Kreatur schon neben ihm herging. Shasta erschrak ganz schrecklich.
Plötzlich fiel ihm ein, daß er vor langer Zeit gehört hatte, es gäbe Riesen hier im Norden. Er zerbiß sich vor Angst die Lippen. Aber er weinte nicht mehr.
Das Tier – oder die Person – ging so still neben ihm her, daß Shasta Hoffnung schöpfte, er habe sich das Ganze nur eingebildet. Aber gerade als er daran zu glauben begann, erklang aus der Dunkelheit neben ihm ein tiefes Seufzen. Das konnte er sich nicht eingebildet haben! Auch hatte er an seiner kalten linken Hand einen heißen Atemstoß gespürt, der den Seufzer begleitet hatte.
Wenn das Pferd etwas getaugt hätte – oder wenn Shasta gewußt hätte, wie man es anstellt, daß ein Pferd etwas taugt – dann würde er versucht haben, einen wilden Galopp anzuschlagen und zu fliehen. Aber er wußte, daß er das Pferd nicht dazu bringen konnte zu galoppieren. Also ritt er im Schritt weiter, und der unsichtbare Begleiter ging schnaufend neben ihm her. Schließlich hielt Shasta es nicht mehr aus.
„Wer bist du?“ fragte er flüsternd.
„Einer, der lange darauf gewartet hat, daß du sprichst“, sagte der unsichtbare Begleiter. Seine Stimme war voll und tief.
„Bist du – bist du ein Riese?“ fragte Shasta.
„Man könnte mich so nennen“, sagte die volle Stimme. „Aber ich bin nicht wie die Geschöpfe, die ihr Riesen nennt.“
„Ich kann dich gar nicht sehen“, sagte Shasta, nachdem er sich sehr angestrengt hatte, etwas neben sich zu erkennen. Dann kam ihm ein noch viel schrecklicherer Gedanke, und er stieß laut hervor: „Du bist – du bist doch wohl nicht tot, oder? O bitte – bitte geh weg. Was habe ich dir denn angetan?“
Wieder spürte er den warmen Atem an der Hand und im Gesicht. „Da!“ sagte der unsichtbare Begleiter. „Dies ist nicht der Atem eines Gespensts. Sag mir, was dich bedrückt.“
Der warme Atem machte Shasta wieder ein klein wenig Mut; so erklärte er dem unsichtbaren Begleiter, daß er seinen richtigen Vater und seine richtige Mutter nie gekannt habe und wie streng ihn der Fischer erzogen hatte. Und dann erzählte er die Geschichte seiner Flucht, wie die Löwen sie gejagt hatten und wie sie um ihr Leben geschwommen waren; er sprach von all den Gefahren in Tashbaan, von der Nacht zwischen den Gräbern und von dem Heulen der Ungeheuer aus der Wüste. Er redete von der Hitze und dem Durst auf auf ihrem Ritt durch die Wüste und wie sie kurz vor dem Ziel noch einmal ein Löwe verfolgt und Aravis verwundet hatte. Er klagte auch, wie lange er schon nichts mehr gegessen hatte. Doch immer wieder kam er auf die Löwen zurück.
„Findest du nicht auch, daß es schrecklich ist, so vielen Löwen zu begegnen?“ wollte Shasta wissen.
„Da war nur ein Löwe“, sagte die Stimme.
„Wie kommst du denn darauf? Ich habe dir doch gerade gesagt, daß es in dieser ersten Nacht mindestens zwei Löwen waren und ... “
„Es war nur einer, aber er war sehr flink.“
„Woher weißt du das?“
„Ich war der Löwe.“ Und als Shasta nach Luft japste und nichts mehr sagte, fuhr die Stimme fort. „Ich war der Löwe, der dich zwang, dich mit Aravis zusammenzutun. Ich war die Katze, die dir bei den Stätten der Toten Trost spendete. Ich war der Löwe, der dir die Schakale vom Leib hielt, als du schliefst. Ich war der Löwe, der den Pferden in ihrem Entsetzen neue Kraft verlieh, damit ihr rechtzeitig bei König Lune ankamt. Und ich war der Löwe, der das Boot anschob, in dem du als kleines Kind und dem Tode nahe lagst, bis es am Strand ankam, wo noch um Mitternacht ein Mann wachte, um dich in Empfang zu nehmen.“
„Dann warst du es, der Aravis verwundete?“
„Ja, das war ich.“
„Aber warum nur?“
„Kind“, sagte die Stimme. „Ich erzähle dir deine Geschichte, nicht die ihre. Ich erzähle jedem nur seine eigene Geschichte.“
„Wer bist du?“ fragte Shasta.
„Ich bin ich“, sagte die Stimme. Sie klang so voll und tief, daß die Erde erbebte. Und noch einmal „Ich bin ich“, laut und klar und froh. Und dann ein drittes Mal „Ich bin ich“, so leise, daß man es kaum hören konnte, und doch schien es von überallher zu kommen, so als stamme es von den raschelnden Blättern.
Shasta hatte keine Angst mehr, die Stimme könne einem Wesen gehören, das vorhatte, ihn zu verspeisen. Es war auch keine Gespensterstimme. Doch ein neues, nie gekanntes Beben überkam ihn. Aber gleichzeitig fühlte er sich glücklich.
Der schwarze Nebel wurde grau und ganz allmählich weiß. Dies mußte schon einige Zeit zuvor begonnen haben, aber solange Shasta mit dem Wesen gesprochen hatte, hatte er auf nichts anderes mehr geachtet. Jetzt begann das Weiß, das ihn umgab, zu funkeln. Er mußte blinzeln. Irgendwo vor sich hörte er Vögel singen. Endlich war die Nacht vorüber. Jetzt sah er deutlich die Mähne, die Ohren und den Kopf seines Pferdes. Von links fiel ein gelber Schimmer darauf. Das mußte wohl die Sonne sein.
Shasta wandte sich um und sah, daß neben ihm ein Löwe daherschritt, der das Pferd überragte. Das Pferd schien jedoch keine Angst vor ihm zu haben, oder vielleicht sah es ihn auch gar nicht. Es war der Löwe, der das Licht ausstrahlte. So etwas Schreckliches und gleichzeitig Schönes hat keiner je gesehen.
Glücklicherweise hatte Shasta nie die Geschichten über den entsetzlichen narnianischen Dämon in der Gestalt eines Löwen gehört, die man sich in Tashbaan erzählte. Und natürlich kannte er auch keine von den wahren Geschichten über Aslan, den großen Löwen, Sohn des Herrschers jenseits des Meeres, König über alle Könige Narnias. Doch nach einem einzigen Blick auf das Gesicht des Löwen glitt Shasta aus dem Sattel und warf sich zu seinen Füßen nieder. Er konnte nichts sagen, und er wußte auch, daß er gar nichts zu sagen brauchte.
Der König aller Könige beugte sich zu ihm herunter. Die Mähne umhüllte ihn und gab ihm ein Gefühl zeitloser Geborgenheit. Dann berührte ihn die Löwenzunge an der Stirn. Shasta hob das Gesicht und sah dem Löwen in die Augen. In diesem Augenblick trafen das fahle Licht des Nebels und das feurige Strahlen des Löwen in phantastischen Wogen aufeinander, vermengten sich und waren verschwunden. Shasta stand mit dem Pferd auf einem grasbewachsenen Hang. Über ihm wölbte sich der blaue Himmel, und die Vögel sangen.
Ob das alles nur ein Traum war? dachte Shasta. Aber es konnte kein Traum gewesen sein, denn vor sich im Gras sah er den tiefen und riesig großen Abdruck der rechten Vordertatze des Löwen. Shasta war sprachlos. Aber es war nicht die Größe der Spur, die ihn am meisten beeindruckte. Noch während er sie betrachtete, hatte sich am Grund Wasser angesammelt. Schon bald war sie ganz angefüllt, dann lief sie über, und schon gleich darauf sprudelte ein Bächlein durch das Gras, vorbei an Shasta und hangabwärts.
Shasta beugte sich nieder und trank. Dann tauchte er das Gesicht hinein und bespritzte sich den Kopf. Das Wasser war sehr kalt, glasklar und erfrischend. Shasta stand auf, schüttelte sich das Wasser aus den Ohren, strich sich das nasse Haar aus der Stirn und sah sich um.
Читать дальше