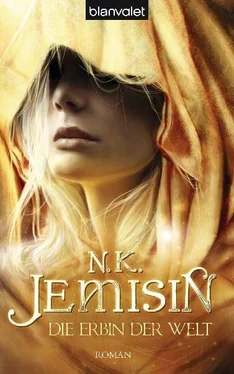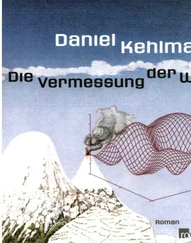»Darf ich keine für mich haben?«, flüsterte ich.
»Was würdest du wollen?«, fragte Nahadoth.
»Was?«
»Wenn du frei sein könntest.« Etwas lag in seiner Stimme, das ich nicht verstand. Schwermut? Ja, und noch mehr. Güte? Zuneigung? Nein, das war unmöglich. »Was würdest du für dich selbst wollen?«
Bei dieser Frage schmerzte mein Herz. Ich hasste ihn, weil er das gefragt hatte. Es war seine Schuld, dass meine Wünsche nie in Erfüllung gehen konnten — seine Schuld und die meiner Eltern, Dekartas und sogar Enefas.
»Ich habe genug davon, nur das zu sein, was andere aus mir gemacht haben«, sagte ich. »Ich will ich selbst sein.«
»Sei nicht kindisch.«
Ich sah erschreckt und ärgerlich hoch, obwohl es natürlich nichts zu sehen gab. »Was?«
»Du bist das, was deine Schöpfer und deine Erfahrungen aus dir gemacht haben, wie jedes andere Wesen in diesem Universum auch. Akzeptiere das und fertig; dein Gejammer ermüdet mich.«
Hätte er das in seiner üblichen kalten Stimme gesagt, wäre ich beleidigt hinausgegangen. Aber er klang wirklich müde, und ich erinnerte mich an den Preis, den er für meine Selbstsucht gezahlt hatte.
In meiner Nähe bewegte sich die Luft erneut, sanft, beinahe wie eine Berührung. Als er sprach, war er näher bei mir. »Die Zukunft kannst du allerdings selbst gestalten, sogar jetzt noch. Sag mir, was du willst.«
Darüber hatte ich — über meine Rache hinausgehend — nie wirklich nachgedacht. Ich wollte ... all die Dinge, die eine junge Frau möchte. Freunde. Familie. Dass diejenigen, die man liebte, glücklich waren.
Und außerdem ...
Ich erschauerte, obwohl es nicht kalt im Zimmer war. Die Fremdartigkeit dieses neuen Gedankens machte mich misstrauisch. War das ein Zeichen von Enefas Einfluss?
Akzeptiere das und fertig.
»Ich ...« Ich schloss meinen Mund, schluckte und versuchte es erneut. »Ich möchte ... etwas anderes für die Welt.« Ah, aber die Welt würde tatsächlich eine andere sein, wenn Nahadoth und Itempas damit fertig waren. Ein Haufen Geröll, unter dem die Menschlichkeit als Ruine begraben lag. »Etwas Besseres.«
»Was?«
»Ich weiß es nicht.« Ich ballte meine Fäuste. Ich hatte Schwierigkeiten, das auszudrücken, was ich sagen wollte, und war über meine eigene Frustration erstaunt. »Jeder hat im Augenblick ... Angst.« Das war schon näher dran. Ich ließ nicht locker. »Wir sind der Gnade der Götter unterworfen und gestalten unser Leben nach euren Launen. Selbst wenn eure Streitigkeiten nichts mit uns zu tun haben, sterben wir. Wie wäre es, wenn ... wenn ihr einfach ... fortgehen würdet?«
»Noch mehr würden sterben«, sagte der Lord der Finsternis. »Die, die uns verehren, würden durch unsere Abwesenheit verängstigt. Einige würden beschließen, dass andere die Schuld daran tragen, und diejenigen, die diese neue Ordnung mit offenen Armen aufnehmen, würden alle ablehnen, die die alten Gebräuche beibehalten. Die Kriege würden Jahrhunderte andauern.«
Tief in meinem Inneren spürte ich die Wahrheit, die in seinen Worten lag, und mir wurde schlecht vor Entsetzen. Dann berührte mich etwas leicht — kühle Hände. Er massierte meine Schultern, als ob er mich trösten wollte.
»Aber irgendwann wären die Kämpfe vorbei«, sagte er. »Wenn ein Feuer ausgebrannt ist, wachsen neue Dinge nach.«
Ich spürte keine Lust oder Wut von ihm, wahrscheinlich weil er im Moment beides nicht für mich empfand. Er war nicht wie Itempas — unfähig, Veränderungen zu akzeptieren. Er verbog nicht alles, was um ihn herum war, oder zerbrach es, um es nach seinem Willen zu formen. Nahadoth verbog sich selbst nach dem Willen anderer. Der Gedanke machte mich einen Moment lang traurig.
»Bist du jemals du selbst?«, fragte ich. »Wirklich du selbst, nicht nur so, wie andere dich sehen?«
Die Hände verharrten, dann wurden sie weggezogen. »Enefa hat mich das einmal gefragt.«
»Tut mir leid ...«
»Nein.« In seiner Stimme lag Trauer. Sie verging niemals für ihn. Wie furchtbar musste es sein, ein Gott der Veränderung zu sein und dann unendliche Trauer zu ertragen.
»Wenn ich frei bin«, sagte er, »werde ich mir aussuchen, wer mich formt.«
»Aber ...« Ich stutzte. »Das ist keine Freiheit.«
»Zu Anbeginn der Wirklichkeit war ich ich selbst. Es gab nichts und niemanden, der mich beeinflusste — nur den Mahlstrom, der mich geboren hatte, und dem war es egal. Ich riss mein Fleisch entzwei, und die Grundsubstanz unseres Reiches ergoss sich daraus: Materie, Energie und mein eigenes, kaltes schwarzes Blut. Ich verschlang meinen Geist und schwelgte in der Neuartigkeit des Schmerzes.«
Tränen schössen in meine Augen. Ich schluckte schwer und versuchte, sie zurückzuhalten, aber plötzlich waren die Hände wieder da und hoben mein Kinn. Finger streichelten meine Augen, schlössen sie und wischten die Tränen fort.
»Wenn ich frei bin, werde ich wählen«, flüsterte er noch einmal ganz nah. »Du musst dasselbe tun.«
»Aber ich werde nie ...«
Er küsste mich, um mich zum Schweigen zu bringen. In dem Kuss lag Sehnsucht, greifbar und bittersüß. War das meine eigene Sehnsucht oder seine? Dann verstand ich endlich: Es machte keinen Unterschied.
Aber o Götter, o Göttin, er war so gut. Er schmeckte wie kühler Morgentau. Er machte mich durstig. Kurz bevor ich mehr wollte, zog er sich zurück. Ich kämpfte gegen die Enttäuschung an, aus Angst, was sie uns beiden antun könnte.
»Geh und ruh dich aus, Yeine«, sagte er. »Lass die Intrigen deiner Mutter sich selbst erfüllen. Du hast deine eigenen Prüfungen zu bestehen.«
Dann fand ich mich in meiner Wohnung. Ich saß auf dem Boden in einem Viereck aus Mondlicht. Die Wände waren dunkel, aber ich konnte gut sehen, da der Mond, obwohl nur ein Bruchstück von ihm tief am Himmel stand, sehr hell war. Mitternacht war längst vorbei, es war ungefähr ein oder zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Das wurde allmählich zur Gewohnheit.
Si’eh saß in dem großen Sessel neben meinem Bett. Als er mich sah, rollte er sich auseinander und legte sich neben mich auf den Boden. Seine Pupillen waren im Mondlicht groß und rund, wie die einer ängstlichen Katze.
Ich sagte nichts. Kurz darauf streckte er die Hand aus und zog mich hinunter, bis mein Kopf in seinem Schoß lag. Ich schloss die Augen und schöpfte Trost aus dem Gefühl seiner Hand auf meinen Haaren. Nach einer Weile begann er, mir ein Schlaflied zu singen, das ich in einem Traum gehört hatte. Ich war entspannt und schlief wohlig ein.
Sag mir, was du willst, hatte der Lord der Finsternis gesagt. Etwas Besseres für die Welt, hatte ich geantwortet. Aber auch ...
Am Morgen ging ich zeitig zum Salon, bevor die Sitzung des Konsortiums begann. Ich hoffte, Ras Onchi zu finden. Vorher sah ich aber Wohi Ubm, die andere Adlige aus Hochnord, die auf der breiten, von Säulen gesäumten Treppe des Salons eintraf.
»Oh«, sagte sie nach einer unbeholfenen Vorstellung und meiner Nachfrage. Sobald ich den mitleidigen Ausdruck in ihren Augen sah, wusste ich es. »Ihr habt es noch nicht vernommen. Ras starb im Schlaf vor zwei Nächten.« Sie seufzte. »Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber nun ja, sie war alt.« Ich kehrte nach Elysium zurück.
Für eine Weile lief ich durch die Flure und dachte über den Tod nach.
Diener nickten mir zu, als sie an mir vorbeigingen, und ich nickte zurück. Höflinge — meine Hochblutkollegen — ignorierten mich entweder oder starrten mich mit offener Neugier an.
Es musste sich herumgesprochen haben, dass ich als Erbin nicht mehr in Frage kam und in aller Öffentlichkeit von Scimina geschlagen worden war. Nicht alle Blicke waren freundlich. Ich neigte auch vor ihnen meinen Kopf. Ich war nicht so engstirnig wie sie.
Читать дальше