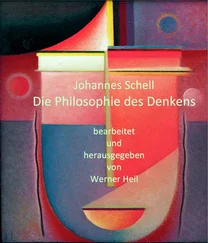„Wofür hat der Mensch gelebt?“ schrie Kondratjuk. „Welchen Nutzen hat er der Welt gebracht? Welchen?“
Seine Söhne nahmen ihn schweigend am Arm und führten ihn in seine Wohnung.
„Wofür hat der Mensch gelebt?“ Kondratjuk schrie noch immer. „Ihr lügt ja alle! Es war umsonst! Umsonst hat er gelebt!“
„Duuu…!“ kreischte seine Frau auf, die stille, unscheinbare Frau. Sie war stets still gewesen, wie schon ihre Mutter und ihre Großmutter. „Wie kannst du das wagen! Du wirst das niemals begreifen!“
War das wirklich seine eigene Frau? Woher nahm sie solche Worte?
„Ich hasse dich! Hasse dich!“ schrie die stille Frau.
Seine Kinder setzten sich nicht für ihren Vater ein.
In Kondratjuks Kopf ging alles durcheinander. Wohl zum ersten Male in seinem Leben dachte er darüber nach, wofür er selbst eigentlich lebte. Wie lebte er? Er hatte weder Diebstahl noch Betrug begangen. Stets hatte er nur das genommen, was ihm dem Gesetz nach zustand. War das etwa nichts? Was müßte man denn noch tun? Was?
Als sie alle vom Friedhof heimkehrten, hatte sich Kondratjuk in das eiskalte Wasser der Mana gestürzt. Man zog ihn heraus, klopfte und schüttelte ihn, und Kondratjuk blieb am Leben.
Timofej Fjodorowitsch hatte Pionow überredet, noch eine Woche in Ust-Mansk zu bleiben. Gemeinsam sichteten sie Tschesnokows Archiv. Ungewöhnlich erregt, vertiefte sich Timofej Fjodorowitsch in den letzten Roman Tschesnokows, den Roman, den er selbst ebenfalls geschrieben hatte. Er war darauf gefaßt gewesen, eine absolute Übereinstimmung anzutreffen. Es war jedoch ein völlig anderer Roman. Timofej Fjodorowitsch hatte sich umsonst aufgeregt.
Pionow nahm das Roman-Manuskript an sich und war fest entschlossen, es unter Tschesnokows Namen zu publizieren. Er hätte am liebsten auch das Manuskript von Timofej Fjodorowitsch mitgenommen. Was ist schon dabei, wenn zwei verschiedene Romane den gleichen Titel haben?
„Das machen wir nicht, Grischa“, sagte Timofej Fjodorowitsch. „Auf die Frage ›Wofür hat der Mensch gelebt?‹ gibt es nur eine einzige Antwort. Wir wollen sie Tschesnokow selbst überlassen.“
In jedem Jahr nehme ich Ende September Urlaub. Die prächtige Jahreszeit im Süden reizt mich nicht, ich bleibe in Ust-Mansk. Früh am Morgen verlasse ich die Wohnung und eile in den Wald. Was zieht mich wohl dorthin? Wenn ich die drei stauberfüllten Wohnviertel und die bimmelnden Straßenbahnen hinter mich gebracht habe, liegt die Stadt bereits in meinem Rücken. Schon bin ich mitten unter Birken. Sie sind halb kahl, und der Wind reißt die noch mit Leben erfüllten, zitternden Blättchen nahezu ununterbrochen von ihnen los. Sie fliegen in verschlungenen Bahnen und sinken sacht auf den Waldboden. Ringsumher erscheint alles golddurchwirkt: der sanfte Regen, der Erdboden, die strahlende Sonne und die flimmernde Luft; dazwischen blitzen nur die schmalen, schneeweißen Birken.
Ich bleibe nicht stehen, sondern laufe weiter, fast renne ich hinunter in die Hexenschlucht. Meine Füße federn auf dem sumpfigen Boden, ich bahne mir meinen Weg durch die Büsche. Sie sind noch völlig grün. Der kleine, verschmutzte und verschlammte Bach, auf dem anderen Ufer die Häuschen der Mitschurin-Gärten, mit Stacheldraht abgezäunt. Weiter, immer weiter, hin zum Fluß. Ich klettere die Uferböschung hinunter, trete dicht an das Wasser heran und schöpfe mir eine Handvoll davon. Fischer stehen mit Gummistiefeln fast bis zur Gürtellinie im Wasser. Sie betrachten mich mißtrauisch. Ich könnte die Fische aufschrecken. Es ist still ringsumher. Nur das Raunen des Flusses ist zu hören, in weiter Ferne das Tuten eines Schiffes und in den Birkenzweigen das zärtliche Flüstern des Windes.
Die Fischer haben keinen Grund zur Beunruhigung, ich laufe weiter. Die ausgetrocknete Wiese von Potap habe ich bereits hinter mir gelassen, auch der Bootsverleih liegt jetzt mit seinen pilzartigen Sonnenschutzdächern verlassen da, vor der Sonne verbergen sich dort zur Zeit lediglich die Schatten ebendieser Pilze. Die Pionierlager sind geschlossen, nur ein Hofhund, wahrscheinlich rein zufällig zurückgeblieben, fristet hier noch sein Dasein, obwohl die Kinder längst in der Stadt sind. Die wuchtigen, tatzenartigen Zweige der Zedern kann der nahende Winter nicht schrecken.
Der Zedernforst bringt mich zur Bassandaika. Während des Sommers ist sie fast gänzlich versiegt, und ich durchquere ihre Furt. Verwundert betrachte ich das eigenartige Farbenspiel: Gold und kräftiges Grün, weiße Streifen und satte Brauntöne; alles miteinander und durcheinander. Die Birken und die Zedern wirken wie Burschen und Mädchen, die sich zum Tanz aufgestellt haben. Nur einen Augenblick kann ich mich hier aufhalten. Ich klettere den Berg hinauf. Wiederum Pionierlager, eine asphaltierte Straße oberhalb des Abhangs. Keine Menschenseele. Schweigen. Nur der Wald spricht. Weiter, immer weiter. Vorbei an einem Feld, auf dem noch Weizen steht, durch Schluchten und durch Birkenwäldchen, die ab und an wie kleine Inseln auftauchen. Ebereschen neigen sich am Abhang. Sie sind fremd und doch so vertraut, daß es einem ans Herz greift. Ich fühle mich beschwingt, nirgends hält es mich, ich eile weiter.
Mein Ziel heißt heute morgen Blaue Felswand. Sie ragt über die träge dahinströmenden Mana als hundert Meter hoher Felsblock auf; graublau, an manchen Stellen verwittert und ausgewaschen von Regen und Wind.
Ich bin am Ziel angekommen.
Abermals begegne ich ihr.
Sie erscheint zwischen den Birken, als habe sie auf mein Kommen gewartet. Heute winkt sie mir nicht zu. Es ist unklar, ob sie fröhlich oder traurig ist. Sie gleitet über die ausgedörrten Birkenblätter dahin wie über einen gelben Teppich. Ungefähr fünf Meter von mir entfernt bleibt sie stehen und sieht mich lange schweigend an.
„Guten Tag“, sage ich.
„Guten Tag“, erwidert sie.
„Ich werde sie also sehen?“
„Hast du es dir nicht anders überlegt? Es ist noch Zeit.“
„Nein. Ich habe alles entschieden.“
Sie kommt auf mich zu und zupft sich das Haar am Kopfwirbel.
… So ist es beim ersten Mal auch gewesen.
Ich habe sie hier an dieser Stelle getroffen. Seit vielen Jahren komme ich Ende September hierher. Sie war damals, so wie heute, plötzlich zwischen den Bäumen aufgetaucht, schwarzhaarig, in einem weißen Kleid. Ich hatte sie angesehen. Es war unmöglich gewesen, sie nicht wenigstens einmal anzuschauen.
Sie würde sowieso vorübergehen, würde mir ausweichen. Aber sie kam zu mir heran.
„Ist es nicht zu kalt für dich in solch einem leichten Kleid?“
fragte ich. Es war tatsächlich kühl. Septembersonne wärmt nicht mehr durch.
„Nein“, erwidert sie.
Wir verstummten. Worüber hätten wir auch reden sollen?
Gelblich glitzernder Regen tröpfelte hernieder. Ich kannte sie und kannte sie auch wieder nicht. Sie ähnelte der Frau, die ich einst geliebt hatte. Das lag jedoch schon sehr lange zurück.
Sie ging weiter, und ich lief neben ihr her.
„Schön ist es hier“, sagte sie.
„Schön.“
Wir kamen an den Abhang. Das gegenüberliegende Ufer der Mana war flach, überflutet, voll kleiner Seen und Wasseradern.
Wir vermochten etwa zwanzig Kilometer ins Land hineinzuschauen, dann war der Horizont in grauen Dunst gehüllt. Ich hatte keine Lust wegzugehen, auch sie ging nicht weiter. Es war angenehm, so neben ihr zu stehen, und ich sprach: „Du bist einer bestimmten Frau sehr ähnlich.“
„Ich weiß.“
„Das kannst du überhaupt nicht wissen. Es liegt sehr lange zurück.“
„Ich weiß alles.“
„Bist du eine Zauberin?“
„Nein, keine Spur“, widersprach sie hastig. „Es ist einfach so, daß ich alles weiß.“
„Dann sag mir, wie sie hieß.“
Читать дальше