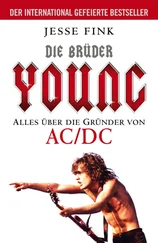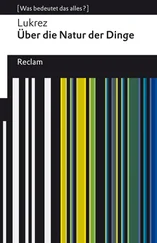«Nein!«Offenbar hat jemand gerufen. Die Kälte brennt auf seinem Gesicht. Er öffnet die Augen, spürt, wie die Schneeflocken auf seinen Pupillen landen. Geradewegs und abwärts schneit es, wie es sich gehört. Tom setzt sich auf, sein Oberkörper schnellt in die Vertikale, wo er eine Parallele zu den Schneeflocken bildet.»So gehört es sich«, murmelt er und steht auf, während er bemerkt, wie sehr er friert. Seine Lippen, die sich kaum mehr bewegen lassen, scheinen etwa zehn Zentimeter von ihm entfernt in der Luft zu schweben.
Zwischen dem fallenden Schnee wird jetzt das Grau der Landschaft sichtbar, durch die Lücken im Weiß schieben sich die Konturen der Berge, und er sieht, dass er falsch gegangen ist. Er sieht, dass es doch mehrere Möglichkeiten gibt, bergab zu gehen. Wie immer ist das Leben komplizierter, als man denkt, denkt er und fühlt sich bestätigt: Das Leben ist kein Campingplatz. Er versucht, sich zu orientieren, sieht, dass er auf dem Rücken eines Sattels steht, der quer über den Gletscher verläuft und zum Fuß des benachbarten Massivs hin führt, dessen Namen er nicht weiß (es ist der Munt Pers). Er muss die Richtung um etwa 30 Grad korrigieren, er muss sein gesamtes Leben um etwa 30 Grad korrigieren. Der Schneefall wird dünner und reißt schließlich ab. Schon nach kurzer Zeit erreicht er die Gletscherkante, den Fahrweg, der ebenfalls eingeschneit ist, aber weit weniger als der Berg. Landschaft und Himmel sind jetzt eternitgrau. Und wieder stumm. Ein schweigendes Gemäuer. Hin und wieder eine vereinzelte dürre Schneeflocke, die verspätet und sehr leise zu Boden sinkt. Er wünscht sich ein heißes Bad und glaubt aufrichtig, dass ein heißes Bad unter Umständen, jetzt zum Beispiel, besser wäre als die gesamte Liebe. Und Schnitzel mit Pommes. Die Schilder der Schweizer Tourismusindustrie wanken an ihm vorüber, 1992, 1990, 1986, 1900. Die Umkehrung der Geschichte. Und dann taucht die Zugstation Morteratsch vor ihm auf, aus dem grauen Hintergrund löst sie sich plötzlich, kommt ihm viel früher als erwartet entgegen wie beim Zoom in eine Nahaufnahme. Der Parkplatz mit dem Hollerschen Opel, nur leicht überzuckert von Schnee. Aber kein Marc sitzt darin. Aber Marc hat den Autoschlüssel.»Scheiße, verflucht!«, murmelt Tom,»Scheiße Scheiße Scheiße«, und tritt mit der Fußkante an den Vorderreifen.
DIE SIGNORA-BONARDI-WOCHE
Am Freitag um 12.35 Uhr war beim EEG der Signora Bonardi aus Pozzuoli eine sogenannte Nulllinie festgestellt worden, die laut offizieller Definition den Zustand des irreversiblen Erloschenseins aller Hirnfunktionen bei einer durch kontrollierte Beatmung noch aufrechterhaltenen Herz-Kreislauf-Funktion, also das landläufig als Tod bezeichnete Lebensende des Komapatienten, markiert. Betty Morgenthal war es, die die Angehörigenfamilie, die gerade beim Mittagstisch saß, telefonisch davon in Kenntnis setzte und die kurz darauf im Ärztezimmer Versammelten über die Möglichkeiten der Organspende aufklärte, indem sie geduldig Fragen beantwortete, zu nichts drängte, aber doch keinerlei Zweifel ließ, dass eine Entscheidung dafür die in moralischer Hinsicht überlegene Position sei.
«Bei allem sollten Sie darüber nachdenken«, sagte sie und blinzelte,»was in ihrem Sinn gewesen wäre, was ihr Wunsch gewesen wäre. «Sie sprach zu den Angehörigen langsam, als wären diese schwerhörig, und entließ sie zur ungestörten Unterredung in den Flur.
Die Tochter, nachdem sich auf ein Klingeln hin die Tür des Ärztezimmers geöffnet hatte, die Familie wieder erschienen war, sagte:»Lunge, Galle und Nieren. «Darauf, auf diese Organe, flüsterte sie, habe man sich geeinigt, denn sicher wäre es in ihrem Sinn gewesen, sagte die Tochter, indem sie Bettys Formulierung übernahm. Dann gingen sie, um Abschied zu nehmen, wie es hieß. Betty, die auf ihrem Drehstuhl saß und Formblätter ausfüllte, kämpfte gegen eine Traurigkeit, während auf ihrem Handy zwei Kurzmitteilungen von Carlo eingingen:»Können wir reden?«Zwei Sekunden später:»Ich MUSS mit dir reden. «Die Traurigkeit, die unprofessionell war, aber sich auch nach Jahren noch einstellte, begann als lähmendes Gefühl in den Oberschenkeln und breitete sich aufsteigend aus. Es war eine Angst, ein Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der Zeit, wenn sie einen Patienten verlor, der sie für eine Woche oder länger begleitet hatte und dieses Zeitstück bemaß, bald vergessen sein würde, Frau Bonardi, Herr Russo, Herr Pignoli, Januar, Februar, März — leere Kalenderblätter.
Die Angehörigen standen vereinzelt und offensichtlich ihres Zentrums beraubt im Ärztezimmer, um sich auch von ihr zu verabschieden. Betty bot ihnen Plätze an, obgleich es nun eigentlich nichts mehr zu reden gab. Dies war jetzt ihr Privatvergnügen, dachte sie und blinzelte, und ob sie noch Fragen hätten.
Nein. Eigentlich nein … Man schüttelte die Köpfe. Aber der Vater, der kaum seine Stimme aus seinem Hals befreien konnte, ließ es sich nicht nehmen, ihr zu danken. Und dass sie gut betreut worden seien, sagte er, und dass ihr keine Frage je zu viel, und danke. Sein Blick verschwand hinter Tränen. Betty reichte ihnen die Hand, begleitete sie nach draußen. Während sich die Schritte der Angehörigen langsam entfernten, blieb sie mit dem Rücken zur Tür stehen und schloss die Augen, drückte Daumen und Zeigefinger an die Nasenwurzel. Was für ein seltsamer Beruf, dachte sie, in dem das Mitleiden von Berufs wegen untersagt ist, was für seltsame Geschehnisse, Beschäftigungen: der Mensch.
Als sie am späten Nachmittag zwischen Terrakottafiguren, Töpfen und Pflanzen in einem Gartencenter in der Provinz Avellino umherging, war Frau Bonardi schon weit. Betty beobachtete die hinkende Silhouette Mariannas, den hageren Umriss Brunos im tiefen Gegenlicht, die jetzt vor einer aufrecht stehenden Hasenfigur verharrten, dann auf ihre breiten Einkaufswägen gestützt weiterzogen. Hinter dem ausladenden Freigelände des Gartencenters erstreckte sich in Richtung Westen, der Autobahn nach Neapel folgend, ein riesiges Areal mit Einkaufshallen, Möbelcentern, Supermärkten, flankiert von bunten Schildern, auf denen sich das Licht fing.
Die Sandris hatten schon, bemerkte Betty, als sie sich näherten, beide Wagen vollgestapelt, konnten sich aber nicht zwischen zwei beinahe identischen Terrakottakübeln entscheiden. Was sie denn meine, die so abwesend erscheinende Schwiegertochter? fragte Marianna. Den linken oder den rechten?
«Tja«, sagte Betty und dachte daran, Alfredo anzurufen, der auf das Auto wartete.»Schwierig«, sagte sie.»Sie sehen ziemlich gleich aus.«
«Aber nein!«, empörte sich Marianna, der linke sei ganz anders als der rechte, erstens drei Zentimeter kleiner, außerdem habe er, im Gegensatz zum rechten, um den Sockel einen Fries mit antikisierendem Muster, während der andere, eher schlicht gehalten sei und so fort.
Betty nickte und legte den Kopf schräg. Aus dem Augenwinkel sah sie Bruno, der mit vorgeneigten Schultern dastand und offenbar angestrengt in sich hineinhorchte, als hätte er in sich etwas verloren.
«Tja«, sagte Betty,»ich würde den linken nehmen«, deutete aber auf den rechten. Brunos Kopf wackelte, obwohl sein Körper stillstand.
«Welchen meinst du denn jetzt?«, fragte Marianna voll wirklicher Verzweiflung. Der linke, obgleich weniger schlicht, sei neun Euro billiger, gab sie zu bedenken. Bruno schwieg noch immer. Jedes Wort Mariannas schien in ihm einen blechernen Widerhall auszulösen, von dem jenes Kopfnicken herrühren musste, das Betty an die politisch unkorrekten Krippemohrenfiguren in den Kirchen ihrer Kindheit erinnerte, die um ebenjener Kopfbewegung willen von den Gläubigen mit Spendenmünzen gefüttert wurden.
«Nick doch nicht zu allem!«, rief Marianna.
Bruno sah sie erstaunt an, nickte und schwieg.
Читать дальше