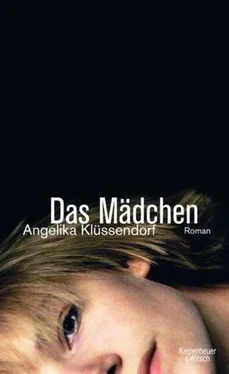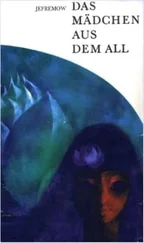Die Mutter ist fast eine Woche nicht zu Hause gewesen, bei ihrer Rückkehr bringt sie ihren Kindern Geschenke mit. Einen großen, blauen Plüschelefanten, Plastikobst und winzige Fläschchen für den Kaufmannsladen. Die Geschenke hält Arno im Arm. Ausgelassen wirbelt er den Plüschelefanten durch die Luft. Arno ist Franzose. Er hat ihrer Mutter eine Parfümflasche geschenkt, die aussieht wie der Eiffelturm. Die Mutter hat ihn in der Mitropa kennengelernt, seine Stimme habe es ihr angetan, verrät sie ihrer Tochter in einem glücklichen Moment. Er zieht aus dem Hotel zu ihnen, doch er kann nur wenige Tage bleiben, dann muss er zurück nach Frankreich. Sie beobachtet, wie ihre Mutter seine Kleidung und die Brieftasche durchsucht. Die Mutter lacht, wenn Arno spricht, gurrend, wie eine Taube, sein Deutsch klingt lustig, als wäre er von der Sprache amüsiert. Nach Arnos Abreise ist die alte Gereiztheit ihrer Mutter wieder da. Sie rechnet den Geschwistern vor, wie teuer sie sind, sie hätte sich ohne Kinder längst ein Auto oder sogar ein Haus kaufen können.
Arno besucht sie noch einmal, doch nach dem ersten heftigen Streit macht er sich schleunigst aus dem Staub. Nach Arno gibt es andere Männer, einen Amerikaner mit Halbglatze, der ihnen Zaubertricks vorführt, einen Österreicher, in dessen kleinem, feuchtem Mund ständig eine Pfeife steckt, und noch einen Franzosen. Die Mutter scheint eine Vorliebe für das kapitalistische Ausland zu haben, zumindest was die Herkunft ihrer Liebhaber betrifft.
Aus irgendeinem Grund beginnt die Mutter, über Körperhygiene zu sprechen, sie will wissen, wie oft sich ihre Tochter untenherum wäscht, ob sie schlechte Gedanken hat. Die Mutter kontrolliert ihre getragenen Schlüpfer, und natürlich kommt sie sich gedemütigt vor, auch deshalb, weil sie so tun muss, als ob sie von nichts eine Ahnung hätte. Was für schlechte Gedanken, fragt sie, und die Mutter spricht es nicht aus, Sex oder Ficken, Wörter, bei denen es ihr heiß wird.
Sie hütet sich, etwas von sich preiszugeben, sie weiß, wie gefährlich das sein kann. Aus einer Laune heraus durfte sie einmal abends mit dem Österreicher und der Mutter einen Film anschauen. Es war ein russischer Kriegsfilm, sie saß auf dem Stuhl neben der Tür und war völlig gebannt von Iwan, einem Jungen, so alt wie sie, der keine Angst kannte. Während die Mutter auf dem Sofa mit neckender Stimme Einwände gegen die Handlung und Schauspieler erhob, wurde sie so mitgerissen, dass sie am Ende des Films leise schluchzte.
Die Mutter stand vor ihr und betrachtete sie voller Abscheu. Ich schäme mich für dich, sagte sie, und dieses Mal traf die Verachtung der Mutter sie ungeschützt.
An einem schon frühlingshaften Abend, als sie das Gebrüll der Mutter über sich ergehen lässt — sie solle endlich abhauen, ihr den Anblick ersparen —, beschließt sie, die Mutter beim Wort zu nehmen. Noch während sie die Treppen herunterspringt, spürt sie Erleichterung und eine fast greifbare Energie. Die erste Nacht verbringt sie bei Elvira im Kleiderschrank, es ist eng, ungemütlich und riecht nach Mottenpulver. Morgens geht sie brav in die Schule, die Lehrer merken nichts, nach der Schule macht sie einen großen Bogen um ihr Haus. In der nächsten Nacht versucht sie, in einem Abrisshaus zu schlafen, doch es ist noch zu kalt, und so streift sie durch die Straßen und wartet darauf, dass im Morgengrauen die Milchkästen vor den Konsum gestellt werden. In der Hofpause spricht sie ein Mädchen aus der Parallelklasse an, Romy, die auch schon einmal von zu Hause ausgerissen ist, und Romy bietet ihr zum Übernachten die Laube ihrer Eltern in einer Kleingartenanlage an.
Mit Proviant versorgt, zieht sie abends in die Laube, der Mond hängt tief, eine helle Scheibe mit Kratern und Rissen, sie versucht sich das Leben dort vorzustellen, ein abenteuerliches Gefühl zu empfinden, doch es gelingt ihr nicht. In der Laube gibt es keinen Strom, und als die Dunkelheit hereinbricht, liegt sie, in Decken gehüllt, auf dem Sofa und wartet darauf einzuschlafen. Am nächsten Tag hat sie keine Lust, in die Schule zu gehen. Sie bleibt einfach liegen, will weder nach draußen noch etwas essen. Als Romy nachmittags mit Freunden vorbeikommt, ist sie schweigsam. Romy besucht sie erst ein paar Tage später wieder, diesmal von zwei Polizisten begleitet. Sie nimmt es Romy nicht übel, dass sie sie verpfiffen hat. Trotzdem beginnt sie zu heulen, sie sieht alles wie durch einen Schleier, der Himmel kommt ihr so niedrig vor, als würde er ihr gleich auf den Kopf fallen. Sie wird aufs Revier gebracht, wo man sie schon erwartet. Da ist ja unsere Ausreißerin, sagt ein Glatzkopf und reicht ihr die Hand. Eine Polizistin fragt, warum sie abgehauen ist, und ihr fällt nichts ein, was sie sagen könnte. Es ist eine Weile still, sie kaut an ihren Fingernägeln, an der Wand hängt ein Bild von Honecker, sie stellt ihn sich kurz ohne sein gleichmütiges Lächeln vor.
Ich will nicht nach Hause, sagt sie.
Musst du auch nicht, sagt der Glatzkopf, dein Vater wird dich holen.
Sie glaubt, sich verhört zu haben, doch dann erklärt ihr die Frau, dass ihr Vater bald auf dem Revier eintreffen werde, das Jugendamt sei bereits in Kenntnis gesetzt und ihre Mutter einverstanden. Sie versucht zu erkennen, ob die Frau lügt oder einfach falsch informiert ist, doch dann hört sie die Stimme ihres Vaters auf dem Korridor.
Erst später, als sie in dem blauen Wartburg hinter ihrem Vater sitzt, kann sie sich beruhigen. Sie mustert die Frau am Steuer. Eine Freundin ihres Vaters? Ihre künftige Stiefmutter? Als hätte sie ihre Gedanken gelesen, dreht sich die Frau zu ihr. Ich heiße Ellen, sagt sie, und sobald dein Vater geschieden ist, werden wir heiraten.
Ellen hat rote Haare, und ihr Bauch ist so mächtig, als wäre sie mindestens im sechsten Monat. Sie wirkt friedlich, vielleicht etwas verschlafen, doch auf jeden Fall friedlich.
Sie weiß nicht, wie sie ihrer Freude Ausdruck verleihen soll; sie schwört sich, ihrem Vater das nie zu vergessen. Er zündet sich eine Zigarette nach der anderen an. Wir fahren zuerst nach Prenzlau, sagt er, und dann weiter an die Ostsee. Er zieht eine kleine Flasche Stonsdorfer aus seinem Jackett und trinkt einen Schluck. Sie hat ihren Vater noch nie im Jackett gesehen.
Hast du Arbeit an der Ostsee? sagt sie.
Wir werden dort im Hotel Atlantik sein, sagt er, später bekomme ich mein eigenes kleines Restaurant. Seine Stimme klingt stolz.
Sie schaut aus dem Fenster, sieht den Himmel dunkel werden, Felder und Bäume fliegen vorbei. Dann hält das Auto, und die Scheinwerfer erfassen ein Haus am Straßenrand. Sie werden von Ellens Mutter begrüßt, einer freundlich aussehenden Frau mit grauen Locken und einer Warze am Kinn.
Als sie im Kinderbett von Ellen liegt, versucht sie sich etwas völlig Neues auszudenken, eine Zeit ohne Tag oder Nacht, doch es kommt nur eine Art Dunst heraus, und während sie noch darüber nachdenkt, ob jetzt alles anders wird, schläft sie ein.
Morgens geht sie leise nach draußen in den Garten. Es riecht nach frischer Erde, die ersten Brennnesseln sind von einem zarten Grün. Sie findet eine tote Schwalbe und beginnt, ihr Grab wie eine Wohnung auszubauen. Die Schwalbe bekommt ein gemütliches Lager aus Gras, die Vorratskammer stopft sie voll mit gelben Sumpfdotterblumen, und sie stellt sich vor, dass die Schwalbe gar nicht tot ist, sondern langsam erwacht, ganz wie bei Däumelinchen im Märchen.
Nach dem Mittagessen wird der Badeofen für sie geheizt, und sie bleibt in der Wanne sitzen, bis das Wasser kalt ist. Später geht Ellen mit ihr in die Stadt und kauft ihr ein Sommerkleid und rote Schuhe, sogar ein Hütchen bekommt sie, das sie natürlich nie aufsetzen wird.
Sie braucht Geld und möchte es nicht stehlen. Sie braucht es, um sich fotografieren zu lassen. Es gibt ein Fotogeschäft auf dem Marktplatz, und sie will unbedingt dokumentieren, wie sie aussieht mit dem neuen Sommerkleid, gleichzeitig schämt sie sich für so einen albernen Wunsch. Schließlich zwingt sie sich, ihren Vater um das Geld zu bitten, und er gibt es ihr, will nicht einmal wissen, wofür sie es möchte.
Читать дальше