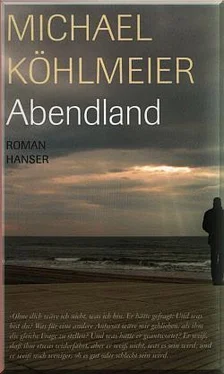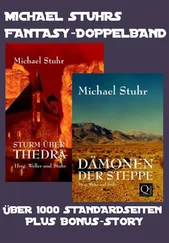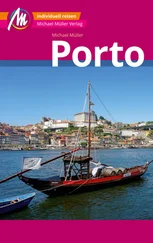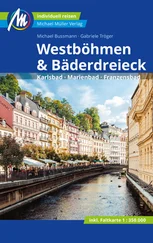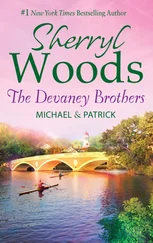Margarida war der Liebling ihres Vaters gewesen. Der war schon in den Fünfzigern, als sie zur Welt kam.»Er hat mir ein Dutzend Vornamen gegeben«, erzählte sie,»gut die Hälfte davon habe ich vergessen, den Rest werde ich dir, auch wenn du mir drohst, mich in den Fluß zu stoßen, nicht nennen, man könnte meinen, ich sei ein Stall voll mit Kühen.«— Das war übrigens typisch für sie: in eine Schlecht- und Lächerlichmacherei zu verfallen, wenn sie über sich selbst sprach. Mich hat sie damit immer zum Lachen gebracht. Carl hat es, glaube ich, nicht so gern gehabt. Wenn sie sich wieder einmal einen» weiblichen Hornochsen «oder einen» zerknitterten Papiersack «oder eine» vergeßliche Schreckenschraube «oder eine» völlig neurotische Kitschnudel «oder einen» alten Aschenbecher «nannte und dabei obendrein die Wörter, absichtlich oder unabsichtlich, falsch betonte, schoß Ungeduld in seinen Blick, und es konnte vorkommen, daß seine Hand auf den Tisch schlug, so heftig, daß ich zweifelte, ob es nur Ungeduld war, was ich in seinen Augen sah. — Noch bevor Margarida in die Schule kam, starb ihre Mutter. Die Eltern hatten sich bis dahin recht wenig um ihre Tochter gekümmert. Der Vater verhätschelte sie zwar, hatte aber immer zuviel zu tun; die Mutter war überschäumend und zugleich nachlässig, einmal freizügig bis zur Verantwortungslosigkeit, dann wieder penibel, engherzig und aufrechnerisch, im einen Augenblick rief sie Margarida zum Wunderkind aus, um sie gleich darauf mit ein paar Worten auf halbe Größe zusammenzuhauen. Margarida wich ihrer Mutter aus, und als diese starb — Margarida:»Ich weiß bis heute nicht, woran. Mein Vater hat immer nur gesagt: Sie ist abgeholt worden«—, weinte sie nicht. Herr Durao aber ging in sich, begab sich mit seiner Tochter an der Hand auf einen kleinen Sonntagspilgermarsch von der Lissabonner Innenstadt nach Belém. Dort fiel er vor dem Altar im Mosteiro dos Jerónimos auf die Knie und erklärte laut, so daß es in der Kirche widerhallte, er werde sich von nun an mit einziger und größter Sorgfalt seinem Kind widmen.
«Und diesen Vorsatz«, erzählte Margarida,»hielt er! Mehr als das! Er hat mich so erzogen, wie er dachte, daß ihn seine Eltern erzogen hatten, mit der Folge, daß aus ihm geworden war, was er war. Du darfst diese Arbeit nicht unterschätzen! Er mußte dabei über eine Parade von Schatten springen. Wieviel einfacher wäre es gewesen, wenn ich ein Knabe gewesen wäre! In Portugal in den zwanziger Jahren war es fast unmöglich, aus einem Mädchen etwas werden zu lassen, was man mit der Stellung eines Mannes vergleichen konnte. Und erst mit der Stellung eines Mannes wie Joaquim Armando Durao! Er wollte, daß ich so werde wie er! Das hat er dem Heiligen in die Augen hinein versprochen! Das war in diesem Land zu dieser Zeit so aufrührerisch, daß man ihn auf der Stelle hätte festnehmen und bis an sein Lebensende einsperren müssen!«
Joaquim Armando Durao war ein bemerkenswerter Mann, und er hatte im Laufe seines Lebens bemerkenswerte Wandlungen durchlaufen. In seiner Jugend war er liberaler Monarchist gewesen. Er gründete in Coimbra eine Tageszeitung, ein paar Jahre später erwarb er die Lizenz für eine zweite dazu, ebenfalls in Coimbra. Er übersiedelte zusammen mit seiner Frau nach Lissabon und kaufte Anteile an drei großen Zeitungen der Stadt, zudem gründete er Blätter in Porto, Braga, Aveiro und Guarda. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts war er einer der reichsten Männer des Landes — ein» lusitanischer Citizen Kane«, wie Carl sagte. Er stiftete einen großen Teil seines Vermögens der Universität seiner Heimatstadt Coimbra für den Aufbau eines modernen wirtschaftswissenschaftlichen Instituts. Die erste radikale Wendung in seinen politischen Anschauungen vollzog er, als König Carlos I. im Jahr 1907 einen gewissen João Franco mit der Bildung einer Regierung beauftragte, der, ohne zu säumen, das Parlament abschaffte und unter dem Schutz der Bajonette und dem Jubel der katholischen Kirche die Diktatur ausrief. Da stellte Herr Durao seine Zeitungen in den Dienst der jungen republikanischen Sache. — »Von einem Monat auf den anderen«, erzählte Margarida,»wurde aus einem Monarchisten ein Republikaner, aus einem Kirchgänger ein Bilderstürmer.«— Die Republikaner erwiesen sich als nicht weniger unfähig als die Monarchisten; eine Regierung löste die andere ab, das Defizit des Staatshaushalts wuchs weiter, England, sonst immer treuer Freund der Portugiesen, feilschte unverhohlen mit Deutschland, wer nach einem abermaligen Staatsbankrott die portugiesischen Kolonien in Afrika und Südostasien kassieren sollte. Aber dann geschah etwas, was die Glocken und die Herzen im ganzen Land zum Schlagen brachte und das Herrn Durao in wenigen Tagen in den inbrünstigen Katholiken verwandelte, als den ihn seine Tochter in Erinnerung hatte: Am 13. Mai 1917 — ein Jahr nach Margaridas Geburt — erschien die Heilige Jungfrau Maria drei Kindern in der Cova da Iria, in der Nähe des Dorfes Fatima. Noch ehe über die religiöse Bedeutung dieses Wunders diskutiert wurde, reklamierten es die antirepublikanischen Kräfte politisch für sich — die Heilige Jungfrau, so hieß es, habe in erster Linie nicht ein allgemeines Zeichen für die allgemeine Menschheit setzen wollen, sondern einen Akt der Parteinahme wider die republikanische Regierung in Portugal. Joaquim Armando Durao wandte sich vom Republikanismus ab und wurde ein strenger Konservativer — und benötigte für diese Metamorphose wieder nur wenige Tage. Nach dem Tod seiner Frau kehrte er mit seiner kleinen Tochter nach Coimbra zurück, wo sie in dem prachtvollen Haus in der Rua Ferreira Borges in der Nähe der Torre de Almedina zwei Stockwerke mit insgesamt zwölf Zimmern bewohnten. Der Vater führte von nun an ein stilles Leben abseits der Tagespolitik. Was nicht hieß, daß er nicht an» der Politik im großen «teilnahm. Margarida erinnerte sich, daß ein Mann des öfteren im Haus ihres Vaters zu Besuch war, ein Professor der Nationalökonomie, der zu dieser Zeit den Lehrstuhl, der von ihrem Vater gestiftet worden war, innehatte. Der Mann war wortkarg, unfröhlich, bescheiden, und er hatte keinen Blick für ein Schulkind, wie aufgeweckt es auch immer sein mochte, zumal es sich um ein Mädchen handelte. Meist kam er in Begleitung von Studenten und Angehörigen des akademischen Mittelbaus, die ihm samt und sonders in Bewunderung ergeben waren, einige schienen ihn wie einen Propheten zu verehren. Zu ihrem siebten Geburtstag schenkte er Margarida eine Halskette mit einem goldenen Kreuz, das Lucia de Jesus, die älteste der drei Fatimakinder, geküßt und gesegnet hatte. Als Mitte der zwanziger Jahre die Republik durch einen Militärputsch abgeschafft wurde, ernannte die neue Regierung diesen Mann zum Wirtschafts- und Finanzminister, später wurde er Staatspräsident und schließlich Diktator. Sein Name: António de Oliveira Salazar. Er blieb an der Macht sechsunddreißig Jahre lang.
Mit knapp achtzehn Jahren schrieb sich Margarida an der Universität in Coimbra ein. Wirtschaftswissenschaften studierte sie, weil für sie und ihren Vater etwas anderes niemals in Betracht gekommen war.»Alle meine Freunde kamen aus der Oberschicht, alle waren katholisch und konform. Ich war eine Ausnahme, weil ich ein Mädchen war, das Nationalökonomie studierte. Aber in unserer Einschätzung des Bürgerkrieges, der hinter unserer Grenze in Spanien ausgebrochen war, unterschieden wir uns nicht: Republik war ein Gerüst des Teufels.«
Sie lernte Daniel Guerreiro Jacinto kennen, Sohn einer mit ihrem Vater befreundeten Familie. Er war ein paar Jahre älter als sie, hübsch und blaß, hatte einen Kopf voll schimmernd schwarzer Locken und einen Mund, der nie lachte. Er studierte ebenfalls Nationalökonomie, war aber alles andere als ein guter Student. Ihm fehlten die meisten Prüfungen, und das war ihm, zu Margaridas Erstaunen, egal. Er konnte sich für nichts begeistern; was in ihr das peinliche Gefühl aufrief, sie selbst gebe es bei allem zu schnell und zu billig.»In Wahrheit«, so erzählte sie mir,»verliebte ich mich in ihn, weil er gar nichts war. Kann man sich das vorstellen? Er stand auf null. Nur ein Grad im Positiven, und ich hätte mich vielleicht nicht in ihn verliebt. Ich wäre womöglich in Verehrung verfallen …«— was ich mir nicht vorstellen konnte —»… oder ein Grad im Negativen, und ich wäre zur Missionarin geworden. Nicht daß er sich selbst verachtet hätte, nein, nicht einmal das tat er. Er war ein Wunder an fehlendem Ehrgeiz. Wie ich vor ihm her über die Travessas zur Universität hinaufgegangen bin — immer blickte er mich an, als wäre ich etwas Besonderes. Nicht daß er etwas großartig Besonderes in mir gesehen hätte, Daniel hatte keinen Sinn für Pathos, nicht für Pathos und nicht für Sentimentalität, er blickte mich an, als wäre ich etwas Besonderes im Rahmen des Normalen. Etwas Besseres gibt es nicht. Daniel war kein spannender Mensch, sicher nicht, aber mit ihm zusammenzusein war spannend, weil ich jedesmal gespannt war, wer werde ich heute sein. Ich habe geredet, und er hat zugehört. Er war nett, traurig, dumm. Ich liebte ihn, weil er traurig war. Daniel wußte so gut wie gar nichts, auch über sich selber nicht. Er wußte nicht, was sein Gesicht tat, was seine Hände taten. Auch nicht, daß er hübsch war. Auch nicht, daß er kein besserer Student wurde, wenn er am Sonntag beim Familienspaziergang, wo es gar nicht gefordert war, mit der Capa e batina herumlief. Das war kein Spleen von ihm oder etwas, was man seinen Stil hätte nennen können, Daniel war ebensowenig auf Stil bedacht wie ein Schimpanse. Er meinte, er stelle damit seine Familie irgendwie zufrieden. Wir haben ihn ausgelacht, mein Vater und ich. Er wußte nicht einmal, ob es Traurigkeit war, was dieses Loch in seiner Brust hinterließ, oder ob dort einfach nie etwas gewesen war.«— Margarida konnte ein herrlich witziges Gesicht ziehen, die Wangen zusammenschieben wie den Balg einer Ziehharmonika. Ihre tiefe Raucherstimme und ihr immer etwas zerzauster Kopf paßten nicht zu ihrer zarten Gestalt. Und ihre zackigen, eckigen Bewegungen waren wie die Bewegungen einer Stummfilmfigur! Ihr Lachen war nahe beim Husten, darum klang es ein wenig ordinär. Auch das mochte ich.
Читать дальше