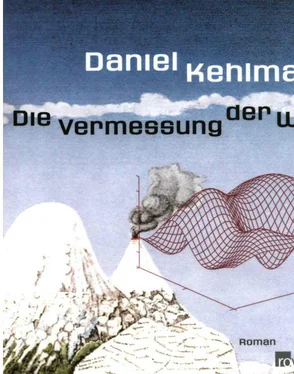Daniel Kehlmann - Die Vermessung der Welt
Здесь есть возможность читать онлайн «Daniel Kehlmann - Die Vermessung der Welt» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2005, Издательство: Rowolt Taschenbuch Verlag, Жанр: Современная проза, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Vermessung der Welt
- Автор:
- Издательство:Rowolt Taschenbuch Verlag
- Жанр:
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Vermessung der Welt: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Vermessung der Welt»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Vermessung der Welt — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Vermessung der Welt», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als er aufwachte, war es heller Morgen, die Hitze war noch stärker geworden, die Fledermaus verschwunden. In makelloser Kleidung, den Degen an der Seite und den Hut unter dem Arm, trat er ins Freie. Der Platz vor der Hütte war leer. Sein Gesicht blutete aus mehreren Schnittwunden.
Bonpland fragte, was ihm passiert sei.
Er habe versucht, sich zu rasieren. Bloß der Moskitos wegen dürfe man nicht verwildern, man sei immerhin ein zivilisierter Mensch. Humboldt setzte sich seinen Hut auf und fragte, ob Bonpland nachts etwas gehört habe.
Nichts Besonderes, sagte Bonpland vorsichtig. Man höre ja viel in der Dunkelheit.
Humboldt nickte. Man träume die seltsamsten Dinge.
Man könne nicht auf alles hören, was man höre, sagte Bonpland.
Man müsse schließlich schlafen, sagte Humboldt.
Am nächsten Tag fuhren sie in den Rio Negro ein, über dessen dunklem Wasser die Moskitos weniger wurden.
Auch die Luft war hier besser. Aber die Gegenwart der Leichen bedrückte die Ruderer, und selbst Humboldt war bleich und schweigsam. Bonpland hielt die Augen geschlossen. Er befürchte, sagte er, sein Fieber komme zurück. Die Affen schrien in ihren Käfigen, rüttelten an den Gittern und schnitten einander Grimassen. Einer bekam sogar die Tür auf, schlug Purzelbäume, belästigte die Ruderer, kletterte am Bootsrand entlang, sprang auf Humboldts Schulter und bespuckte den knurrenden Hund.
Mario bat Humboldt, auch einmal etwas zu erzählen.
Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könne das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt.
Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig, und bald werde man tot sein.
Alle sahen ihn an.
Fertig, sagte Humboldt.
Ja wie, fragte Bonpland.
Humboldt griff nach dem Sextanten.
Entschuldigung, sagte Julio. Das könne doch nicht alles gewesen sein.
Es sei natürlich keine Geschichte über Blut, Krieg und Verwandlungen, sagte Humboldt gereizt. Es komme keine Zauberei darin vor, niemand werde zur Pflanze, keiner könne fliegen oder esse einen anderen auf. Mit einer schnellen Bewegung packte er den Affen, der gerade versucht hatte, ihm die Schuhe zu öffnen, und steckte ihn in den Käfig. Der Kleine schrie, schnappte nach ihm, streckte die Zunge heraus, machte große Ohren und zeigte ihm sein Hinterteil. Und wenn er sich nicht irre, sagte Humboldt, habe jeder auf diesem Boot Arbeit genug!
Bei San Carlos zeigte die Inklinationsnadel steil ab-wärts, während die Kompaßnadel sich nur zögernd für den Norden entschied. Humboldt betrachtete die Instrumente mit andächtiger Miene. Der magnetische Äquator.
Von diesem Ort hatte er als Kind geträumt.
Gegen Abend erreichten sie die Mündung des legendä-
ren Kanals. Sofort stürzten Mückenschwärme auf sie ein.
Doch mit der Wärme verzog sich der Dunst, der Himmel wurde klar, und Humboldt konnte den Längengrad bestimmen. Er arbeitete die ganze Nacht. Er maß den Winkel der Mondbahn vor dem südlichen Kreuz, dann, zur Kontrolle, fixierte er stundenlang mit dem Teleskop die Geisterflecken der Jupitermonde. Nichts sei zuverlässig, sagte er zu dem ihn aufmerksam beobachtenden Hund. Die Tabellen nicht, nicht die Geräte, nicht einmal der Himmel. Man müsse selbst so genau sein, daß einem die Unordnung nichts anhaben könne.
Erst in den frühen Morgenstunden war er soweit. Er klatschte in die Hände. Aufstehen, keine Zeit verlieren!
Ein Endpunkt des Kanals sei bestimmt, man müsse schnell zum anderen.
Verschlafen fragte Bonpland, ob er befürchte, jemand könne ihm zuvorkommen. Am Ende der Welt, nach all den Jahrhunderten, in denen der gottverdammte Fluß keinen Menschen interessiert habe.
Man wisse nie, sagte Humboldt.
Das Gebiet war auf keiner Karte verzeichnet, sie konnten nur ahnen, wohin das Wasser sie trug. Die Baumstämme standen so eng, daß man nicht ans Ufer konnte, und alle paar Stunden benetzte feiner Sprühregen die Luft, ohne Kühlung zu bringen oder die Insekten zu vertreiben. Bonplands Atem machte pfeifende Geräusche.
Es sei nichts, sagte er hustend, er wisse bloß nicht, ob das Fieber in ihm oder in der Luft sei. Als Arzt empfehle er, nicht tief einzuatmen. Er vermute, die Wälder strömten ungesunde Dämpfe aus. Vielleicht liege es auch an den Leichen.
Ausgeschlossen, sagte Humboldt. An den Leichen liege es nicht.
Endlich fanden sie eine Stelle zum Anlegen. Mit Ma-cheten und Beilen hackten sie einen kleinen Platz für die Übernachtung frei. Über den Flammen ihres Lagerfeuers knallten zerplatzende Moskitos. Eine Fledermaus biß den Hund in die Nase, er blutete stark, drehte sich brummend um sich selbst und wollte nicht ruhig werden. Er flüchtete unter Humboldts Hängematte, sein Knurren hinderte sie lange am Einschlafen.
Am nächsten Morgen brachten Humboldt und Bonpland es nicht fertig, sich zu rasieren, ihre Gesichter waren von den Insektenstichen zu geschwollen. Als sie ihre Beulen im Fluß kühlen wollten, bemerkten sie, daß der Hund fehlte. Humboldt lud hastig das Gewehr.
Keine gute Idee, sagte Carlos. Der Urwald sei nirgendwo dichter, die Luft zu feucht für Waffen. Den Hund habe ein Jaguar geholt, da sei nichts zu machen.
Ohne zu antworten, verschwand Humboldt zwischen den Bäumen.
Neun Stunden später waren sie immer noch da. Zum siebzehnten Mal kam Humboldt zurück, trank Wasser, wusch sich im Fluß und wollte wieder los. Bonpland hielt ihn auf.
Es helfe nichts, der Hund sei weg.
Nie und nimmer, sagte Humboldt. Er gestatte es nicht.
Bonpland legte ihm die Hand auf die Schulter. Der Hund sei verdammt noch einmal tot!
Vollkommen tot, sagte Julio.
Ganz und gar hinüber, sagte Mario.
Das sei, sagte Carlos, gewissermaßen der toteste Hund aller Zeiten.
Humboldt sah sie alle, einen nach dem anderen, an. Er öffnete und schloß den Mund, dann legte er das Gewehr zu Boden.
Erst Tage darauf kam wieder eine Siedlung in Sicht. Ein vom Schweigen blöd gewordener Missionar begrüßte sie stotternd. Die Menschen waren nackt und bunt gefärbt: Einige hatten sich Fräcke auf die Körper gemalt, andere Uniformen, die sie selbst nie gesehen haben konnten.
Humboldts Miene hellte sich auf, als er erfuhr, daß an diesem Ort Curare angefertigt wurde.
Der Curaremeister war eine würdevolle, priesterlich hagere Gestalt. So, erklärte er, schabe man die Zweige, so zerreibe man die Rinde auf einem Stein, so fülle man, Vorsicht, den Saft in einen Bananenblatttrichter. Auf den Trichter komme es an. Er bezweifle, daß Europa etwas ähnlich Kunstvolles hervorgebracht habe.
Nun ja, sagte Humboldt. Es sei zweifellos ein sehr re-spektabler Trichter.
Und so, sagte der Meister, dampfe man den Stoff in einem Tongefäß ab, aufpassen bitte, selbst das Hinschau-en sei gefährlich, so füge man eingedickten Blätteraufguß hinzu. Und dies, er hielt Humboldt das Tonschälchen hin, sei nun das stärkste Gift dieser und jeder anderen Welt. Damit könne man Engel töten!
Humboldt fragte, ob man es trinken könne.
Man trage es auf Pfeile auf, sagte der Meister. Es zu trinken habe noch keiner versucht. Man sei ja nicht wahnsinnig.
Aber die getöteten Tiere könne man sofort essen?
Das könne man, sagte der Meister. Das sei der Sinn der Sache.
Humboldt betrachtete seinen Zeigefinger. Dann steckte er ihn in die Schüssel und leckte ihn ab.
Der Meister stieß einen Schrei aus.
Keine Sorge, sagte Humboldt. Sein Finger sei heil, seine Mundhöhle auch. Wenn man keine Wunden habe, müsse der Stoff verträglich sein. Die Substanz wolle erforscht werden, er habe es also zu riskieren. Übrigens bitte er um Verzeihung, ihm sei ein wenig schwach zumute. Er sank auf die Knie und blieb eine Weile auf der Erde sitzen. Er rieb sich die Stirn und summte leise vor sich hin. Dann stand er behutsam auf und kaufte dem Meister alle Vorräte ab.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Vermessung der Welt»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Vermessung der Welt» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Vermessung der Welt» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.