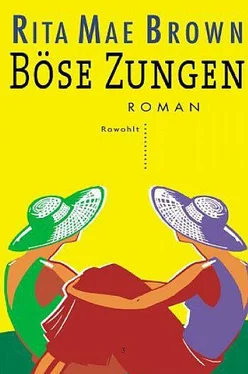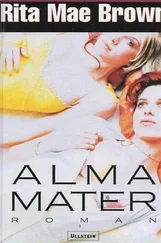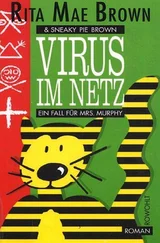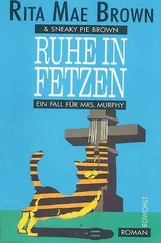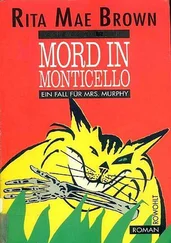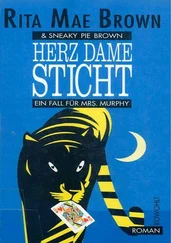Er seufzte. »Ich versprech's.«
Mutter Smith ließ sich zum Runnymede Square chauffieren. Sie war in einer Zeit geboren, da livrierte Kutscher auf dem Bock saßen. Sie hatte einmal gehört, daß verwegene Damen im Londoner Hyde Park ihre Karossen eigenhändig kutschierten, aber das würde sie ganz bestimmt nicht tun.
Mutter Smith wähnte sich als Herzogin, die dazu verdammt war, in einer Demokratie zu leben, noch dazu in einer genesenden Demokratie. Franklin D. Roosevelt, der seine dritte Amtszeit ausübte, hatte Washingtons Warnung in den Wind geschlagen, daß zwei Amtszeiten für einen Präsidenten genug seien. Mutter Smiths Wahn festigte sich mit den Jahren, bis er die Konsistenz von Beton besaß, welche nur zu oft auch die Konsistenz ihrer intellektuellen Fähigkeiten zu sein schien. Die Holtzapples, ihre Familie, hatten weder großen Reichtum noch großes Talent noch große Ländereien besessen. Einige erwiesen sich als annehmbare Zeitgenossen, doch selbst bei großzügigster Auslegung konnte man sie nicht als vornehme Familie bezeichnen. Die Smiths auch nicht, die der Dunker-Sekte angehörten und in bescheidenen Verhältnissen lebten, eine Familie, in die Josephine 1889 eingeheiratet hatte. Immerhin konnten sie einen Staatssekretär vorweisen, der Millard Fillmore, dem 13. Präsidenten der Vereinigten Staaten, gedient hatte. Rupert war genau wie seine Söhne ein gut aussehender Mann, und er betrieb ein einträgliches Bauunternehmen, aber reich war er nicht. Als Josephine Rupert heiratete, hatte sie geglaubt, ihn mit der Zeit verändern, ihn an ihren Lebensstandard heranführen zu können. Die Jahre hatten sie von dieser Illusion ebenso geheilt wie von ihrer Liebe zu Rupert.
Leute in ihrem Alter erinnerten sich, daß Josephine schon immer eine hohe Meinung von sich hatte, die mit zunehmendem Alter an Höhe gewann. Sie hatte keine Freundinnen, tat aber, als sei es ihr egal. Sie lebte für ihre Familie, was bedeutete, daß ihre Söhne Gefangene ihrer Tyranneien waren; zwei waren entkommen, und Chester war zu Hause geblieben. Ein Masochist. Obwohl er ihre Sticheleien und Schikanen an sich abprallen ließ, gab es Tage, da er sich, gefangen zwischen dem eisernen Willen seiner Mutter und der Unberechenbarkeit seiner Frau, wie ein heißes Hufeisen auf einem Amboß vorkam.
Heute war ein solcher Tag.
Als seine Mutter zu dem Wachturm hinter der St.- Pauls-Kirche hochsah, den Bisammantel eng um sich gerafft, murrte sie: »Warum tust du dir diese Strapazen an? Selbst wenn die Deutschen uns angriffen, würden sie sich nicht mit Runnymede abgeben.«
»Die Hindenburg ist drübergeflogen.« Er erinnerte sie an den letzten verhängnisvollen Flug des Zeppelins, der über Runnymede kreuzte, während er darauf wartete, daß der Wind in New Jersey, wo das Luftschiff festmachen sollte, abflaute.
»Chester, widersprich mir nicht.« Die Kälte machte sich bemerkbar, und sie tippelte mit kleinen Schritten zum Auto zurück.
»Wenn wir im Pazifik bessere Beobachtungsposten hätten, wären wir vielleicht für den japanischen Angriff gewappnet gewesen. Wir hätten möglicherweise Zeit gehabt, unsere Schiffe aus Pearl Harbor zu entfernen.«
»Hätten, könnten, sollten, würden. ich behaupte trotzdem, daß es keinen erdenklichen Grund für dich oder sonst jemanden gibt, auf den Turm zu klettern und in der Kälte zu sitzen, worauf wartet ihr - auf Bomber?« Mit dem Fuß aufstampfend stand sie vor der Beifahrertür.
Chester öffnete den Wagenschlag, half ihr hinein, ging auf die andere Seite und rutschte hinters Steuer. »Soll ich dich bei Tante Dimps absetzen? Ich habe einen Termin. Ich könnte dich so gegen halb vier wieder abholen.«
»Wo gehst du hin?«
»Zu Dr. Horning.«
»Bist du krank?« Besorgnis schlich sich in ihre Stimme.
»Nein. Es ist Zeit für eine gründliche Untersuchung.«
»Mir siehst du gesund aus.«
»Bin ich auch, aber ich bin auch in einem Alter, in dem ich mich nicht unbedingt darauf verlassen sollte.«
»Papperlapapp, du bist noch keine Vierzig.«
»Wo soll ich dich absetzen, Mutter?«
»Nicht bei Tante Dimps. Daß wir zusammen zur Schule gegangen sind, heißt noch lange nicht, daß ich mir auf ihrem Klavier Bach anhören will. Ich könnte deinen Vater besuchen. Er ist erkältet, aber er wollte unbedingt zur Arbeit gehen.«
»Juts war furchtbar lange erkältet.«
Sie überhörte das und verschränkte die Arme. »Fahr schon, Chester.«
»Okay.« Er drehte den Zündschlüssel herum und fuhr auf die Straße; sirrend senkten sich die Schneeketten in die festgefahrene Schneedecke.
»Fehlt dir etwas? Ich habe Johnny sterben sehen. Wenn dir etwas fehlt, will ich es wissen.« Chesters älterer Bruder war gestorben, als Chester sechs war. John war Josephines Liebling gewesen. Sie sprach selten von ihm, aber seine Fotografie stand neben ihrem Bett.
»Ich sterbe nicht. Ich lasse mich untersuchen.«
»Juts steckt dahinter. Ich weiß es.« Als er nicht antwortete, ging sie zum Angriff über. »Verdorbenes Blut. Das ist das Zepp'sche Erbe, sage ich dir - und die Buckinghams hatten auch einen wüsten Zug, wie jeder weiß. Also, dieser Vorfall mit Otto Tangerman.« Sie hielt inne, senkte die Stimme. »Ich meine Günther, Ottos Vater, also das war unverzeihlich.« Sie starrte vor sich hin, als würde Chessy sie an etwas erinnern, das vor seiner Geburt geschehen war.
»Ah. welcher, Mutter, es gab so viele Vorfälle.«
»Das meine ich, das verdorbene Blut.«
»Und was war mit Günther Tangerman?«
»Hans, Coras Vater, hat den Leichnam aus der Leichenhalle gestohlen, ihm seine Uniform angezogen und ihn auf George Gordon Meades Statue gehievt. Das hab ich dir schon mal erzählt«, brummte sie, dann fuhr sie fort: »Er hat ihn rittlings hinter Meade gesetzt, die Arme um die Taille des Generals. Am nächsten Morgen sind alle furchtbar erschrocken. Die alte Priscilla McGrail ist bei dem Anblick in Ohnmacht gefallen. Hans hat die Angelegenheit, wie er es nannte, nie verwunden, obwohl er und Günther Freunde waren.«
Die Angelegenheit bestand darin, daß Günther bei den Unionisten gekämpft hatte, während Hans auf Seiten der Konföderation gewesen war.
»Was meinte Major Chalfonte dazu?«
»Daß Günther tot fester im Sattel saß als lebendig. Oh, es war ein furchtbarer Schock.« Sie faltete die behandschuhten Hände. »Wohin fährst du mich?«
»Zu Dad, oder hast du eine bessere Idee?«
»Hab ich dir gesagt, du sollst mich zu ihm fahren?« Ihre Augenbrauen schnellten fragend in die Höhe.
»Nein, du hast gesagt, er hat sich erkältet.«
»Oh.« Sie überlegte. »Das hab ich wohl, oder? Chester, ich möchte Rupert nicht sehen. Er ist nicht ganz auf der Höhe. Vielleicht bringst du mich besser nach Hause.«
»Wollen wir ins Bon-Ton? Bestimmt haben sie gerade eine weiße Woche; Julia spricht immer davon.«
»Ich brauche keine Bettwäsche.«
»Vielleicht sind auch Kleider heruntergesetzt.«
»Ich habe keine Zeit für diesen modernen Firlefanz, wo man alles durchsieht. Wenn ich Frauen mit so dünnen Fähnchen am Leib sehe, frage ich mich wirklich, was für ihre Ehemänner noch zum Anschauen übrig bleibt. Die Jugend von heute hat keinen Anstand.«
»Wir könnten zum Mittagessen zu Cadwalder gehen.«
»Davon kriege ich Blähungen.«
»Schön, dann bringe ich dich nach Hause.« Er fuhr langsam, weil er sich trotz der Schneeketten nicht auf die Griffigkeit der Reifen verließ. »Mutter, Julia möchte ein Kind.«
»Das habe ich schon mal gehört.«
»Sie ist besorgt wegen ihres Alters. Sie fürchtet, wenn wir noch warten, ist sie zu alt, um ein Kind zu bekommen.«
»Deine Frau ist selbst ein Kind. Sie könnte kein Kind erziehen.«
Читать дальше