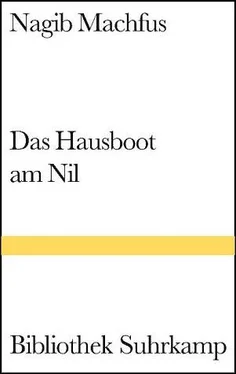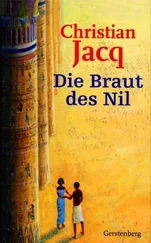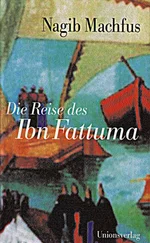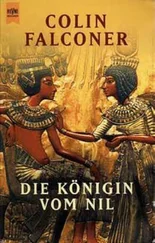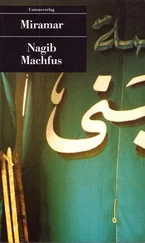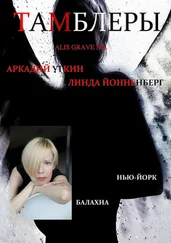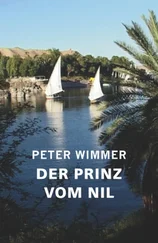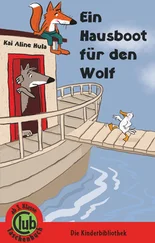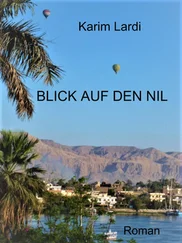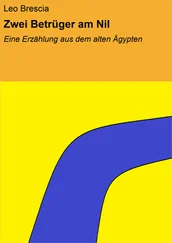Man könnte aus diesem Beispiel einen grundsätzlichen Unterschied im Verständnis oder in der Rezeption von Moderne und Avantgarde zwischen Orient und Okzident herauslesen. Bis heute trägt dieser Unterschied dem Westen von seiten vieler traditionell eingestellter Muslime den Vorwurf der Dekadenz und Unmoral ein. Während der Westen die sexuelle Freiheit des Individuums als essentielle Errungenschaft der Moderne begreift, wird diese Freiheit in der arabischen Literatur bis weit in die achtziger Jahre als moralischer Verfall gedeutet. Erst eine jüngere, in den achtziger und neunziger Jahren auftretende Schriftstellergeneration hat es gewagt, mit diesen traditionellen Vorstellungen zu brechen, die sich bei Machfus, aller Modernität der Form ungeachtet, immer wieder finden. Die kleinbürgerlich-konservative Grundhaltung macht die Größe und die Beschränkung des Werks von Machfus gleichermaßen aus. Dieselbe Zurückhaltung, die verhindert, daß sich seine Werke in die höchsten Höhen des Literaturhimmels aufschwingen, sorgt dafür, daß sie nie in extreme Niederungen oder selbstgefällige Experimente abgleiten. Machfus ist eben kein Revolutionär, kein Existentialist, kein Bilderstürmer und in der Kunst kein Experimentator und Avantgardist. Aber zeit seines Lebens ist Machfus auch in politischer Hinsicht immer ein umsichtiger, moderater Geist gewesen, der allen ideologischen Versuchungen widerstanden hat, ohne deswegen auf ein klares Engagement zu verzichten. Seine lesenswerte Nobelpreisrede, die in einen flammenden Appell an die Erste Welt mündet, endlich ihrer Verantwortung gegenüber der Dritten gerecht zu werden, zeugt davon.
In aufgeregten Zeiten wirkt das Machfussche Credo, das persönliche ebenso wie gesellschaftliche Verantwortung betont, auf Konsens bedacht ist und radikal individuellen Lebensentwürfen ebenso eine Absage erteilt wie jeglichem politischen Fanatismus, wenig spektakulär. Es kann passieren, daß man achtlos oder sogar abschätzig darüber hinwegliest. Und doch wird von Jahr zu Jahr klarer, daß es von einem Humanismus zeugt, den nicht nur die arabische Welt heute dringend benötigt.
Stefan Weidner Köln, Juli 2004
Mu'izz ad-Din al-Fatimi (931—975) : Er gründete 969 die Stadt Kairo.
Ibrahim Pascha : Sohn Muhammad Alis, erfolgreicher Heerführer.
Ramadan : Name des 9. Monats des islamischen Kalenders, Fastenmonat.
Al-Ma'mura : Vornehmer Vorort von Alexandria.
Ibn Tulun, Ahmed (835—884) : Gründer der Tuluniden-Dynastie in Ägypten.
Muluhiya : Eine dünne Suppe aus grünen, feingehackten Blättern.
Al-Ma'arri, Abu >Ala< (973—1057) : Berühmter arabischer Dichter, von Kindheit an blind. Philosophischer Skeptiker und Kritiker des religiösen Formalismus.
Feddan : Flächenmaß, etwa 4200 Quadratmeter.
Al-Khayyam, 'Omar (Omar Chajjam, gest. 1050) : »Omar der Zeltmacher«, persischer Mathematiker und Dichter. In Europa bekannt durch seine »Vierzeiler«.
Maidan : Wörtlich »Platz«, hier Verkehrsknotenpunkt.
Azharit (Azhari): Student oder Absolvent der islamischen Universität al-Azhar in Kairo.
Hidschra (Al-Higra) : Die Auswanderung des Propheten Muhammad von Mekka nach Medina im Jahre 622.
Al-Fatiha : Die erste Sure des Koran.
Al-Hakim bi Amri 'l-Allah (Der Herrscher von Gottes Gnaden): Fatimidenkalif in Ägypten von 996 bis zu seinem geheimnisvollen Verschwinden im Jahr 1021. Zur Reinigung der Sitten verbot er bestimmte Speisen und Getränke und belegte Verstöße dagegen mit der Todesstrafe.
Lailat al-qadr (die Nacht der Bestimmung): Religiöses Fest der Sündenvergebung, gewöhnlich die Nacht zum 27. Ramadan.