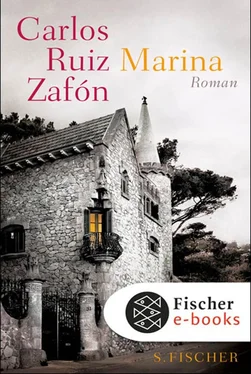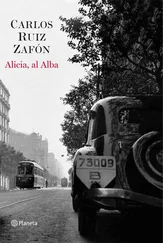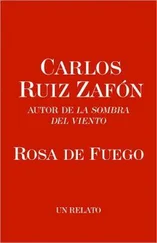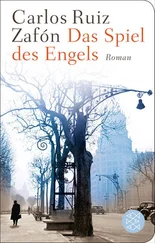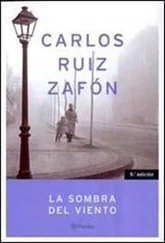»Was kann ich tun?«, murmelte ich.
»Bleib hier bei mir.«
Sie setzte sich vor einen Spiegel. Vergeblich versuchte sie, mit einer Bürste etwas Ordnung in den Wirrwarr der Haare zu bringen, die ihr auf die Schulter fielen. Sie hatte keine Kraft.
»Lass mich es tun.«Ich nahm ihr die Bürste aus der Hand.
Schweigend kämmte ich sie, während sich unsere Blicke im Spiegel trafen. Dabei ergriff Marina kräftig meine Hand und drückte sie gegen ihre Wange. Ich spürte ihre Tränen auf meiner Haut und hatte nicht den Mut, sie nach dem Grund für diese Tränen zu fragen.
Ich begleitete sie in ihr Zimmer und half ihr ins Bett. Sie zitterte nicht mehr, und in ihre Wangen war die Wärme zurückgekehrt.
»Danke«, flüsterte sie.
Ich dachte, am besten lasse ich sie ruhen, und kehrte in mein Zimmer zurück. Dort legte ich mich wieder ins Bett und versuchte vergeblich einzuschlafen. Unruhig lag ich im Dunkeln und hörte das alte Haus knacken und den Wind in den Bäumen knarren. Blinde Beklemmung nagte an mir. Allzu viele Dinge ereigneten sich allzu schnell. Mein Gehirn war außerstande, sie alle gleichzeitig zu verarbeiten. In der Dunkelheit des frühen Morgens schien alles zu verschwimmen. Doch nichts erschreckte mich mehr als meine Unfähigkeit, meine Gefühle für Marina zu verstehen oder sie mir zu erklären. Es wurde schon hell, als ich endlich einschlief.
Im Traum ging ich durch die Säle eines verlassenen, im Dunkeln liegenden weißen Marmorpalasts. Hunderte von Statuen waren aufgestellt. Wenn ich vorbeiging, öffneten die Gestalten ihre Steinaugen und flüsterten unverständliche Worte. Da glaubte ich in der Ferne Marina zu erblicken und lief auf sie zu. Eine weiße Engelsgestalt führte sie an der Hand durch einen Gang mit blutenden Wänden. Ich versuchte sie einzuholen, als eine der Türen im Gang aufging und María Shelleys Gestalt erschien, über dem Boden schwebend und ein abgetragenes Totenhemd mitschleppend. Sie weinte, aber ihre Tränen gelangten nie auf den Boden. Sie streckte mir ihre Arme entgegen, und als sie mich berührte, zerfiel ihr Körper zu Asche. Ich rief Marinas Namen, bat sie zurückzukommen, doch sie schien mich nicht zu hören. Ich lief und lief, aber der Gang wurde immer länger. Da wandte sich der Lichtengel zu mir um und offenbarte mir sein wahres Gesicht. Seine Augen waren leere Höhlen und seine Haare weiße Schlangen. Der Höllenengel lachte grausam, legte seine weißen Flügel um Marina und entfernte sich. Im Schlaf roch ich einen stinkenden Atem im Nacken. Es war der unverwechselbare Todesgestank, der meinen Namen flüsterte. Ich wandte mich um und sah, wie sich mir ein schwarzer Schmetterling auf die Schulter setzte.
Ich erwachte atemlos und müder als beim Zubettgehen. Meine Schläfen pochten, als hätte ich zwei Kannen schwarzen Kaffee getrunken. Ich wusste nicht, wie spät es war, aber nach dem Sonnenstand zu urteilen, musste es etwa Mittag sein. Die Zeiger des Weckers bestätigten meine Vermutung – halb eins. Eilig ging ich hinunter, doch das Haus war menschenleer. Auf dem Küchentisch erwartete mich das Frühstück, schon erkaltet, zusammen mit einer Notiz.
Óscar,
wir mussten zum Arzt und werden den ganzen Tag weg sein. Vergiss das Futter für Kafka nicht. Wir sehen uns beim Abendessen.
Marina
Ich las die Notiz noch einmal und studierte die Handschrift, während ich herzhaft dem Frühstück zusprach. Einige Minuten später machte Kafka seine Aufwartung, und ich servierte ihm seine große Tasse Milch. Ich wusste nicht, was ich mit diesem Tag anfangen sollte, und beschloss, ins Internat zu gehen, um einige Kleider zu holen und Doña Paula zu sagen, sie solle sich nicht bemühen, in meinem Zimmer sauberzumachen, ich würde die Ferien bei meiner Familie verbringen. Der Spaziergang zum Internat tat mir gut. Ich betrat es durch den Haupteingang und stieg in den dritten Stock zu Doña Paulas Wohnung hinauf.
Doña Paula war eine herzensgute Person, die immer ein Lächeln für die Internatsschüler übrighatte. Sie war seit dreißig Jahren Witwe und seit weiß Gott wie viel länger auf Diät.»Ich neige halt zum Dickwerden, wissen Sie«, sagte sie immer. Sie hatte keine Kinder und verschlang mit einem bloßen Blick auch mit ihren fast fünfundsechzig Jahren noch sämtliche Babys, denen sie auf dem Gang zum Markt in ihren Kinderwagen begegnete. Sie lebte in Gesellschaft ihrer beiden Kanarienvögel und eines riesigen Zenit-Fernsehers, den sie erst ausschaltete, wenn die Nationalhymne und die Bilder der Königsfamilie sie ins Bett schickten. Ihre Hände waren von der Lauge verschrumpelt. Wenn man die Adern ihrer aufgequollenen Knöchel anschaute, schmerzte es einen selbst. Der einzige Luxus, den sie sich zugestand, waren alle zwei Wochen ein Besuch beim Friseur und die Zeitschrift ¡Hola! . Mit Vergnügen las sie über das Leben von Prinzessinnen und bewunderte die Kleider der Stars aus dem Showbusiness. Als ich bei ihr anklopfte, schaute sie sich gerade eine Neuinszenierung von Die Pyrenäennachtigall in einem Musicalzyklus mit Joselito in der»Abendvorstellung«an. Das Spektakel begleitete sie mit einer Portion Toastscheiben, dick bestrichen mit Kondensmilch und Zimt.
»Tag, Doña Paula. Entschuldigen Sie die Störung.«
»Oh, Óscar, mein Junge, du störst mich doch nicht. Komm nur rein!«
Auf dem Bildschirm sang Joselito unter dem wohlwollend-entzückten Blick von zwei Zivilgardisten einem Zicklein ein Liedchen vor. Neben dem Fernseher teilte eine Sammlung von Muttergottesfigürchen die Ehrenvitrine mit den alten Fotos ihres Gatten Rodolfo, ganz Brillantine und funkelnagelneue Falangeuniform. Trotz der Verehrung ihres verstorbenen Gatten freute sich Doña Paula sehr über die Demokratie, da jetzt, wie sie sagte, das Fernsehen in Farbe sei und man auf dem Laufenden zu sein habe.
»Ach, was für ein Lärm neulich nachts, nicht? In der Tagesschau haben sie das mit dem Erdbeben in Kolumbien gebracht, und Herr du meine Güte, ich weiß auch nicht, da hab ich plötzlich so ne Angst gekriegt…«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Doña Paula, Kolumbien ist weit weg.«
»Das stimmt schon, aber dort reden sie ja auch Spanisch, ich weiß nicht, ich meine…«
»Keine Bange, es ist ganz ungefährlich. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie brauchen sich nicht um mein Zimmer zu kümmern. Ich werde Weihnachten bei meiner Familie verbringen.«
»Ach, wie schön, Óscar!«
Doña Paula hatte mich mehr oder weniger groß werden sehen und war überzeugt, alles, was ich tue, sei goldrichtig.»Du hast echtes Talent«, sagte sie immer, obwohl sie nie genau erklären konnte, wozu. Ich musste unbedingt ein Glas Milch trinken und von ihren selbstgebackenen Plätzchen essen, obwohl ich überhaupt keinen Appetit hatte. Eine Weile blieb ich noch bei ihr, schaute mir den Fernsehfilm an und nickte zu all ihren Kommentaren. Die gute Frau redete wie ein Wasserfall, sobald sie Gesellschaft hatte, was fast nie vorkam.
»Der war doch wirklich süß als Junge, nicht wahr?«Sie deutete auf den arglosen Joselito.
»Ja, stimmt, Doña Paula. Jetzt muss ich aber gehen…«
Ich küsste sie zum Abschied auf die Wange und machte mich davon. Für eine Minute lief ich in mein Zimmer hinauf und raffte eilig einige Hemden, eine Hose und frische Unterwäsche zusammen. Das alles packte ich in eine Tüte, ohne eine Sekunde länger als nötig zu verweilen. Danach ging ich beim Sekretariat vorbei und wiederholte mit unerschütterlichem Gesicht meine Geschichte von Weihnachten im Familienkreis. Beim Gehen dachte ich, wenn doch alles so einfach wäre wie Lügen.
Schweigend aßen wir im Salon mit den Bildern zu Abend. Germán war zurückhaltend, in sich selbst versunken. Manchmal trafen sich unsere Blicke, und er lächelte mir aus reiner Höflichkeit zu. Marina rührte mit dem Löffel in einem Teller Suppe herum, führte ihn aber nie zum Mund. Die ganze Unterhaltung beschränkte sich auf das Schaben des Bestecks auf den Tellern und das Knistern der Kerzen. Unschwer konnte ich mir ausmalen, dass der Arzt nichts Gutes über Germáns Gesundheit gesagt hatte. Ich beschloss, keine Fragen zu etwas Offensichtlichem zu stellen. Nach dem Essen empfahl sich Germán und zog sich auf sein Zimmer zurück. Er wirkte gealtert und müder denn je. Das war das erste Mal, seit ich ihn kannte, dass er die Bilder seiner Frau Kirsten nicht zur Kenntnis nahm. Sowie er verschwunden war, schob Marina ihren noch vollen Teller von sich und seufzte.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу