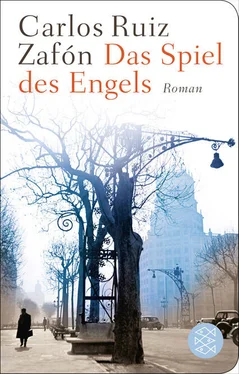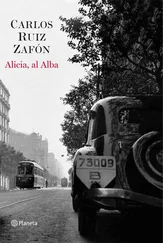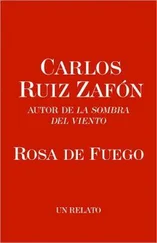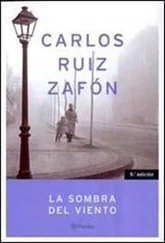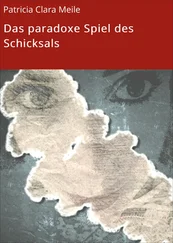»Sie dürfen die Hoffnung nicht verlieren, mein Freund«, sagte er. »Wir machen große Fortschritte. Haben Sie Vertrauen.«
Gehorsam stimmte ich zu und ging Tag für Tag ins Sanatorium, um mit Cristina zum See zu spazieren und mir diese geträumten Erinnerungen anzuhören, die sie mir Dutzende Male erzählt hatte, aber täglich von neuem entdeckte. Täglich fragte sie mich, wo ich gewesen sei, warum ich sie nicht geholt, warum ich sie allein gelassen habe. Täglich schaute sie mich zwischen den Gitterstäben ihres unsichtbaren Käfigs hindurch an und bat mich, sie zu umarmen. Täglich fragte sie mich beim Abschied, ob ich sie liebe, und immer gab ich dieselbe Antwort.
»Ich werde dich immer lieben. Immer.«
Eines Nachts weckte mich ein Klopfen an meiner Zimmertür. Es war drei Uhr früh. Benommen schleppte ich mich zur Tür und sah mich einer der Krankenschwestern des Sanatoriums gegenüber.
»Dr. Sanjuán hat mich gebeten, Sie zu holen«, sagte sie.
Zehn Minuten später betrat ich die Villa San Antonio. Die Schreie waren schon im Park zu hören. Cristina hatte ihre Tür von innen verriegelt. Dr. Sanjuán, der aussah, als hätte er seit einer Woche nicht mehr geschlafen, und zwei Pfleger versuchten sie aufzubrechen. Drinnen hörte man Cristina schreien und gegen die Wände toben, Möbel umwerfen und Gegenstände zerschmettern.
»Wer ist da bei ihr?«, fragte ich wie erstarrt.
»Niemand«, antwortete der Arzt.
»Aber sie spricht mit jemandem…«
»Sie ist allein.«
Ein Nachtwächter kam mit einer langen Metallstange angerannt.
»Das ist alles, was ich gefunden habe«, sagte er.
Der Arzt nickte, und der Nachtwächter rammte die Stange in den Türspalt und stemmte sich mit aller Kraft dagegen.
»Wie hat sie von innen abschließen können?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht…«
Zum ersten Mal glaubte ich im Gesicht des Arztes Angst zu lesen; er wich meinem Blick aus. Kurz bevor der Nachtwächter die Tür aufbrechen konnte, wurde es drinnen plötzlich still.
»Cristina?«, rief der Arzt.
Keine Antwort. Endlich gab die Tür nach und sprang auf. Ich folgte dem Arzt ins Zimmer, das im Halbdunkel lag. Das Fenster stand offen, und ein eisiger Wind drang herein. Tische, Stühle und Sessel waren umgeworfen, die Wände verschmiert, sie wirkten wie mit dunkler Farbe beschriftet. Blut. Von Cristina keine Spur.
Die Pfleger rannten auf den Balkon hinaus und suchten den Park nach Spuren im Schnee ab. Der Arzt sah sich links und rechts nach Cristina um. Da hörten wir ein Lachen aus dem Bad. Ich ging zur Tür und öffnete sie. Cristina saß auf dem scherbenübersäten Boden und lehnte wie eine kaputte Puppe an der Metallwanne. Ihre über und über zerschnittenen Hände und Füße bluteten. Vom gesprungenen Spiegel, den sie mit den Händen zertrümmert hatte, rann immer noch ihr Blut. Ich legte die Arme um sie und suchte ihren Blick. Sie lächelte.
»Ich habe ihn nicht hereingelassen«, sagte sie.
»Wen?«
»Er wollte, dass ich vergesse, aber ich habe ihn nicht hereingelassen«, wiederholte sie.
Der Arzt kniete neben mir nieder und untersuchte die Schnittwunden, die Cristinas Körper bedeckten.
»Bitte«, flüsterte er und schob mich beiseite. »Nicht jetzt.«
Einer der Pfleger hatte eilig eine Trage geholt. Ich half ihnen, Cristina darauf zu betten, und hielt ihre Hand, während sie in ein Untersuchungszimmer gebracht wurde. Dort injizierte ihr Dr. Sanjuán ein Beruhigungsmittel, das ihr in Sekundenschnelle das Bewusstsein nahm. Ich blieb bei ihr und schaute zu, wie ihre Augen ein leerer Spiegel wurden, bis mich eine der Schwestern aus dem Raum zog. Mitten im halbdunklen, nach Desinfektionsmitteln riechenden Gang blieb ich stehen, die Hände und Kleider blutbefleckt. Ich lehnte mich an die Wand, ließ mich langsam zu Boden gleiten.
Als Cristina am nächsten Tag erwachte, war sie mit Lederriemen am Bett festgebunden, eingeschlossen in einem fensterlosen, einzig von einer gelblichen Glühbirne an der Decke beleuchteten Raum. Ich hatte sie auf einem Stuhl in der Ecke die ganze Nacht beobachtet und wusste nicht mehr, wie viel Zeit verstrichen war. Plötzlich riss sie vor Schmerz die Augen auf, als sie die stechenden Wunden auf ihren Armen spürte.
»David?«, rief sie.
»Ich bin hier.«
Ich trat ans Bett und beugte mich über sie, damit sie mein Gesicht und das blutarme, für sie einstudierte Lächeln sähe.
»Ich kann mich nicht bewegen.«
»Du bist mit Riemen festgebunden. Es ist zu deinem Besten. Sobald der Doktor kommt, wird er sie dir abnehmen.«
»Nimm du sie mir ab.«
»Das darf ich nicht. Nur der Doktor kann…«
»Bitte«, bettelte sie.
»Cristina, es ist besser, wenn…«
»Bitte.«
In ihrem Blick lagen Schmerz und Angst, vor allem aber eine Klarheit und Geistesgegenwart, die ich in all den vergangenen Tagen nicht an ihr gesehen hatte. Sie war wieder sie selbst. Ich löste die oberen Riemen über Armen und Taille. Dann streichelte ich ihr Gesicht. Sie zitterte.
»Ist dir kalt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Soll ich den Doktor holen?«
Wieder schüttelte sie den Kopf.
»David, sieh mich an.«
Ich setzte mich auf die Bettkante und schaute ihr in die Augen.
»Du musst es vernichten«, sagte sie.
»Ich verstehe dich nicht.«
»Du musst es vernichten.«
»Was?«
»Das Buch.«
»Cristina, am besten hole ich den Doktor…«
»Nein. Hör mir zu.«
Sie umklammerte meine Hand.
»Der Vormittag, an dem du die Fahrkarten geholt hast, weißt du noch? Da bin ich noch einmal in dein Arbeitszimmer hinaufgegangen und habe die Truhe geöffnet.«
Ich seufzte.
»Ich habe das Manuskript gefunden und zu lesen begonnen.«
»Es ist nur eine Fabel, Cristina…«
»Lüg mich nicht an. Ich habe es gelesen, David. Zumindest so viel, um zu erkennen, dass ich es vernichten musste…«
»Mach dir deswegen jetzt keine Sorgen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich das Manuskript vergessen habe.«
»Aber er hat dich nicht vergessen. Ich habe versucht, es zu verbrennen…«
Als ich sie das sagen hörte, ließ ich einen Moment lang ihre Hand los — bei der Erinnerung an die verbrannten Streichhölzer auf dem Boden des Arbeitszimmers musste ich eine kalte Wut unterdrücken.
»Du hast versucht, es zu verbrennen?«
»Aber ich konnte nicht«, flüsterte sie. »Da war noch jemand in der Wohnung.«
»Niemand war in der Wohnung, Cristina. Niemand.«
»Sowie ich das Streichholz angezündet hatte und es ans Manuskript hielt, hörte ich ihn hinter mir. Ich habe einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und bin hingefallen.«
»Wer hat dich geschlagen?«
»Alles war ganz dunkel, als hätte sich das Tageslicht zurückgezogen und könnte nicht mehr herein. Ich drehte mich um, aber alles war ganz dunkel. Ich habe nur seine Augen gesehen. Augen wie von einem Wolf.«
»Cristina…«
»Er hat mir das Manuskript aus den Händen genommen und wieder in die Truhe gelegt.«
»Cristina, es geht dir nicht gut. Lass mich den Doktor holen und…«
»Du hörst mir nicht zu.«
Lächelnd küsste ich sie auf die Stirn.
»Natürlich höre ich dir zu. Aber es war niemand sonst in der Wohnung…«
Sie schloss die Augen, wandte den Kopf ab und stöhnte, als würden ihr meine Worte die Eingeweide umdrehen.
»Ich hole den Doktor…«
Ich beugte mich über sie, um sie wieder zu küssen. Dann ging ich, ihren Blick im Rücken spürend, zur Tür.
»Feigling«, sagte sie.
Als ich mit Dr. Sanjuán ins Zimmer zurückkam, hatte Cristina eben den letzten Riemen gelöst und wankte auf die Tür zu, blutige Fußspuren auf den weißen Fliesen hinterlassend. Gemeinsam hielten wir sie fest und legten sie wieder aufs Bett. Sie schrie und wehrte sich so verbissen, dass einem das Blut in den Adern gefror. Der Lärm alarmierte das Personal der Krankenstation. Ein Pfleger half uns, sie zu bändigen, während der Arzt sie wieder festschnürte. Als sie sich nicht mehr rühren konnte, schaute er mich ernst an.
Читать дальше