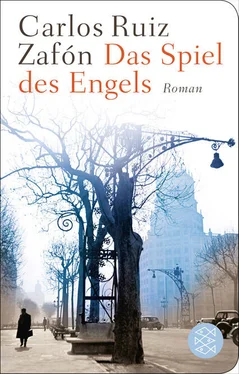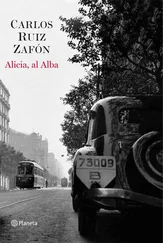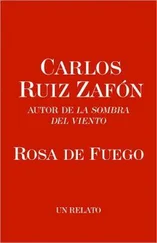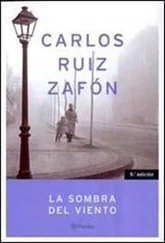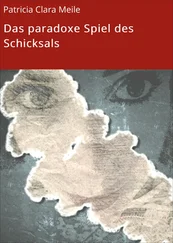Schlechte Ideen kommen selten allein. Zur Feier der Entdeckung dieser verborgenen Dunkelkammer ging ich zu Sempere und Söhne, um den Buchhändler zum Mittagessen in die Maison Dorée einzuladen. Er las gerade in einer kostbaren Ausgabe von Potockis Handschrift von Saragossa und mochte von meinem Vorschlag nichts hören.
»Wenn ich Snobs und sonstige Trottel sehen will, die sich aufspielen und gegenseitig beglückwünschen, brauche ich dafür nicht zu bezahlen, Martín.«
»Seien Sie kein Spielverderber — ich lade Sie ja ein.«
Er lehnte ab. Sein Sohn, der das Gespräch auf der Schwelle zum Hinterzimmer verfolgt hatte, schaute mich zweifelnd an.
»Und wenn ich Ihren Sohn einlade, was dann? Verbieten Sie es mir?«
»Sie müssen selbst wissen, wofür Sie Zeit und Geld verschwenden. Ich bleibe hier und lese, das Leben ist kurz.«
Sempere junior war ein Musterbeispiel an Schüchternheit und Verschwiegenheit. Obwohl wir uns von Kindesbeinen an kannten, konnte ich mich nicht entsinnen, mit ihm mehr als drei, vier Unterhaltungen geführt zu haben, die länger als fünf Minuten gedauert hätten. Ich kannte an ihm weder Laster noch Sünden. Dagegen wusste ich aus verlässlicher Quelle, dass er bei den Mädchen des Viertels als der offizielle Frauenschwarm und gute Partie galt. Mehr als eine kam unter irgendeinem Vorwand zur Buchhandlung und blieb seufzend vor dem Schaufenster stehen, doch Semperes Sohn, wenn er es denn überhaupt bemerkte, unternahm nie einen Schritt, um diese Wechsel auf Ergebenheit und schmachtende Lippen einzulösen. Jeder andere hätte mit einem Zehntel dieses Kapitals eine glänzende Karriere als Windhund gemacht. Jeder außer Sempere junior, bei dem man manchmal nicht wusste, ob man ihn seligsprechen sollte.
»Wenn das so weitergeht, bekommt er noch einen Heiligenschein«, lamentierte Sempere bisweilen.
»Haben Sie schon mal versucht, ihm ein wenig Paprika in die Suppe zu geben, um an den Schlüsselstellen die Bewässerung zu stimulieren?«, fragte ich.
»Lachen Sie nur, Sie Halunke, ich bin bald siebzig und habe noch immer keinen gottverdammten Enkel.«
Wir wurden von dem Oberkellner empfangen, den ich von meinem letzten Besuch her noch in Erinnerung hatte, allerdings ohne serviles Lächeln oder Willkommensgeste. Als ich ihm sagte, ich hätte nicht reserviert, nickte er verächtlich und schnippte mit den Fingern einen Hilfskellner herbei, der uns formlos an den schlechtesten Tisch des Saals führte, neben der Küchentür in einem dunklen, lauten Winkel. In den folgenden fünfundzwanzig Minuten bequemte sich niemand an unseren Tisch, nicht einmal, um uns die Karte oder ein Glas Wasser zu bringen. Das Personal ging türenschlagend vorbei, ohne uns und unsere Winke auch nur im Geringsten zur Kenntnis zu nehmen.
»Meinen Sie nicht, wir sollten wieder gehen?«, fragte Sempere junior schließlich. »Ich komme gut mit einem belegten Brötchen aus, egal, wo…«
Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als sie hereinkamen. In Begleitung des Oberkellners und zweier Kellner, die sich in Beglückwünschungen ergingen, steuerten Vidal und seine Gattin ihren Tisch an. Sie nahmen Platz, und zwei Minuten später setzte die Prozession der Gäste ein, die einer nach dem anderen an Vidals Tisch traten, um ihm zu gratulieren. Er empfing sie mit gottgleicher Gnade und entließ sie kurz darauf wieder. Der junge Sempere, der die Situation erfasst hatte, beobachtete mich.
»Martín, fühlen Sie sich gut? Warum gehen wir nicht?«
Ich nickte langsam. Wir standen auf und gingen in größtmöglicher Entfernung von Vidals Tisch an der Wand entlang dem Ausgang zu. Der Oberkellner würdigte uns keines Blickes, und kurz vor dem Ausgang sah ich im Spiegel über dem Türrahmen, wie Vidal sich zu Cristina hinüberbeugte und sie auf die Lippen küsste. Auf der Straße sah mich Sempere gequält an.
»Tut mir leid, Martín.«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Es war eine schlechte Wahl, das ist alles. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, bitte zu Ihrem Vater…«
»… kein Wort davon«, versicherte er.
»Danke.«
»Keine Ursache. Wie wäre es, wenn ich Sie an einen etwas volkstümlicheren Ort einlade? In der Calle del Carmen gibt es einen ganz außergewöhnlichen Mittagstisch.«
Mir war der Appetit vergangen, aber ich stimmte gern zu.
»Gehen wir.«
Das Lokal befand sich in der Nähe der Bibliothek und servierte günstige Hausmannskost für die Leute aus dem Viertel. Ich rührte das Essen kaum an, obwohl es unendlich viel besser duftete als alles, was ich in der Maison Dorée je erschnuppert hatte. Als der Nachtisch kam, hatte ich ganz allein bereits anderthalb Flaschen Roten geleert und verspürte einen ordentlichen Rausch.
»Sempere, sagen Sie mir eines. Was haben Sie eigentlich dagegen, frisches Blut in ihre Sippe zu bringen? Oder wie sonst erklärt es sich, dass ein junger, gesunder, vom Allmächtigen mit Ihrem Aussehen gesegneter Bürger noch nicht das saftigste Wild seines Reviers erlegt hat?«
Der Buchhändlersohn lachte.
»Was bringt Sie auf den Gedanken, ich hätte es nicht getan?«
Ich führte meinen Zeigefinger an die Nase und zwinkerte ihm zu. Er nickte.
»Auf die Gefahr hin, dass Sie mich für scheinheilig halten — ich mag die Vorstellung, dass ich warte.«
»Worauf? Darauf, dass Sie die Maschinerie nicht mehr in Gang kriegen?«
»Sie reden wie mein Vater.«
»Weise Männer sind sich immer einig.«
»Ich denke, es gibt noch was anderes, oder?«, fragte er.
»Etwas anderes?«
Er nickte.
»Was weiß ich«, sagte ich.
»Ich glaube, Sie wissen es durchaus.«
»Tja, so ist es wohl.«
Ich wollte mir nachschenken, aber Sempere hielt mich zurück.
»Vorsicht«, murmelte er.
»Sehen Sie, wie scheinheilig Sie sind?«
»Jeder ist, wie er ist.«
»Dem kann abgeholfen werden. Was halten Sie davon, wenn wir beide jetzt auf Brautschau gehen?«
Er sah mich mitleidig an.
»Martín, ich glaube, Sie gehen jetzt besser nach Hause und ruhen sich aus. Morgen ist ein neuer Tag.«
»Sie werden Ihrem Vater doch nicht sagen, dass ich mir einen Affen angetrunken habe, nicht wahr?«
Auf dem Heimweg machte ich in nicht weniger als sieben Kneipen halt, um von ihren Hochprozentigen zu kosten, bis man mich jeweils unter irgendeinem Vorwand auf die Straße setzte und ich nach hundert Metern einen neuen Hafen anlief. Ich war nie ein ausdauernder Trinker gewesen, und so war ich am Abend schließlich sternhagelvoll und wusste nicht einmal mehr, wo ich wohnte. Ich erinnere mich, dass mich zwei Kellner des Gasthauses Ambos Mundos auf der Plaza Real je an einem Arm auf eine Bank vor dem Brunnen schleppten, wo ich in einen tiefen, dunklen Schlaf fiel.
Ich träumte, ich ginge zu Don Pedros Beerdigung. Ein blutiger Himmel überzog das Labyrinth von Kreuzen und Engeln rund um das große Mausoleum der Vidals auf dem Montjuïc-Friedhof. Eine schwarz verschleierte Trauerschar säumte das dunkle Marmorrund, das die Säulen vor dem Mausoleum bildeten. Jeder der Anwesenden trug eine hohe weiße Altarkerze. Im Licht von hundert Flammen wurde der Umriss eines großen, schmerzvoll blickenden Marmorengels auf einem Sockel sichtbar, zu dessen Füßen sich das offene Grab meines Mentors mit einem gläsernen Sarg befand. Vidals Leiche, ganz in Weiß, ruhte mit offenen Augen unter dem Glas. Schwarze Tränen rannen ihm über die Wangen. Die Gestalt der Witwe, Cristina, löste sich aus dem Gefolge und fiel tränenüberströmt vor dem Sarg auf die Knie. Der Reihe nach zogen die Trauernden am Verstorbenen vorbei und legten schwarze Rosen auf den Glassarg, bis er so weit bedeckt war, dass man nur noch das Antlitz sah. Zwei gesichtslose Totengräber senkten den Sarg ins Grab, dessen Grund von einer dicken, dunklen Flüssigkeit überschwemmt war. Der Sarg schwamm auf einem Teppich von Blut, das langsam durch die Ritzen der gläsernen Verschlüsse drang. Nach und nach füllte er sich, und das Blut bedeckte Vidals Leichnam. Bevor sein Gesicht ganz verschwand, bewegte mein Mentor die Augen und schaute mich an. Ein Schwarm schwarzer Vögel flog auf, und ich lief davon und verirrte mich auf den Wegen der unendlichen Totenstadt. Nur durch ein fernes Weinen fand ich wieder zum Ausgang und konnte den Klagen und Bitten der dunklen Schattengestalten entkommen, die sich mir in den Weg stellten und mich anflehten, sie mitzunehmen, um sie aus ihrer ewigen Finsternis zu erretten.
Читать дальше