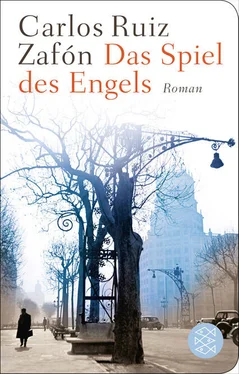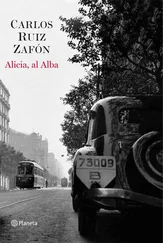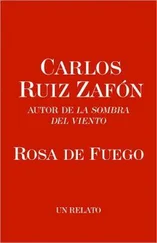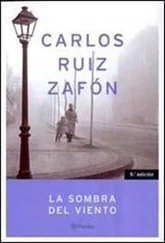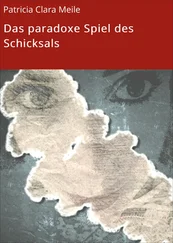»Machen Sie keinen Druck, das ist Präzisionsarbeit. Da muss man strategisch vorgehen.«
»Und was haben Sie vor?«
»Zunächst mal frühstücken gehen.«
»Aber Sie sind doch erst vor einer halben Stunde gekommen.«
»Señor Martín, mit dieser Einstellung kommen wir nicht weiter.«
Das Trauerspiel von Bauarbeiten und Pfuschereien dauerte eine Woche länger als vorgesehen, aber selbst mit Otilio und seinen Wunderknaben, die an Unorten Löcher bohrten und zweieinhalbstündige Frühstückspausen einlegten, hätte ich vor lauter Vorfreude, endlich in diesem Traumhaus zu wohnen, notfalls Jahre bei Kerzen- und Öllicht verbracht. Zu meinem Glück war das Ribera-Viertel nicht nur ein geistiges Reservoir, sondern verfügte auch über Handwerker aller Art. Einen Katzensprung von meinem neuen Domizil entfernt fand ich einen, der mir neue Schlösser installierte, die nicht aussahen wie von der Bastille abgeschraubt, sowie Wandleuchten und Armaturen. Die Vorstellung, Telefon zu haben, überzeugte mich nicht, und nach dem, was ich aus Vidals Rundfunkempfänger gehört hatte, zählte ich nicht zum anvisierten Publikum der von der Presse so apostrophierten »Wellenübertragungsmaschinen«. Ich beschloss, mich mit Büchern und Stille zu umgeben. Aus der Pension nahm ich nichts weiter mit als etwas frische Wäsche und das Kästchen mit der Pistole meines Vaters, das einzige Andenken an ihn. Meine restlichen Kleider und persönlichen Gebrauchsgegenstände verteilte ich an die anderen Pensionsgäste. Hätte ich auch Haut und Erinnerung zurücklassen können, ich hätte es getan.
An dem Tag, als der erste Band der Stadt der Verdammten erschien, verbrachte ich meine erste Nacht in dem elektrifizierten Haus mit Turm. Der Roman war eine frei erfundene, verwickelte Geschichte rund um den
›Träumerei‹-Brand von 1903 und ein geisterhaftes Geschöpf, das seither durch die Straßen des Raval spukte. Noch bevor die Druckerschwärze der Erstausgabe trocken war, begann ich schon die Arbeit am zweiten Roman der Reihe. Nach meinen Berechnungen musste Ignatius B. Samson bei monatlich dreißig Tagen ununterbrochener Arbeit im Durchschnitt täglich 6,66 taugliche Manuskriptseiten produzieren, um den Vertrag zu erfüllen, was ein Wahnsinn war, aber den Vorteil hatte, dass mir nicht viel Freizeit blieb, um mir dessen bewusst zu sein.
Ich merkte kaum, dass ich, während die Tage dahingingen, allmählich mehr Kaffee und Zigaretten konsumierte als Sauerstoff. Je mehr ich mein Hirn vergiftete, desto mehr hatte ich den Eindruck, es werde zu einer Dampfmaschine, die gar nicht mehr abkühlte. Ignatius B. Samson war jung und zäh. Ich arbeitete die ganze Nacht und sank in der Morgendämmerung wie gerädert in seltsame Träume, in denen sich die Buchstaben auf dem Blatt in der Schreibmaschine vom Papier lösten und wie Spinnen über meine Hände und mein Gesicht liefen, durch die Haut drangen und sich in meinen Adern einnisteten, bis mein Herz schwarz überzogen war und mein Blick mit dunklen Tintenpfützen umwölkt. Wochenlang verließ ich das alte Haus kaum und vergaß, welcher Tag und welcher Monat es war. Ich schenkte den Kopfschmerzen keine Beachtung, die mich immer wieder schlagartig befielen, als bohrte sich mir ein Metallstichel in den Schädel, und mir mit einem weißen Blitz die Sicht versengten. Ich hatte mich daran gewöhnt, mit einem dauernden Pfeifen in den Ohren zu leben, das nur das Raunen des Windes oder der Regen übertönen konnte. Wenn kalter Schweiß mein Gesicht bedeckte und meine Hände auf der Tastatur der Underwood zitterten, nahm ich mir manchmal vor, am nächsten Tag den Arzt aufzusuchen. Doch dann galt es, an diesem Tag wieder eine weitere Szene und eine weitere Geschichte zu erzählen.
Als Ignatius B. Samson ein Jahr alt wurde, beschloss ich, mir zu seinem Geburtstag einen freien Tag zu schenken und mich wieder mit der Sonne, dem Wind und den Straßen der Stadt auszusöhnen, die ich nicht mehr betreten hatte, um sie mir nur noch in der Phantasie vorzustellen. Ich rasierte mich, machte mich zurecht und schlüpfte in meinen besten Anzug. Ich öffnete die Fenster des Arbeitszimmers und der Veranda, um die Wohnung durchzulüften und den dichten Dunst, der zu ihrem ureigenen Geruch geworden war, in alle Winde zu zerstreuen. Als ich auf die Straße hinunterging, steckte in der Spalte unter dem Briefkasten ein großer Umschlag. Darin fand ich ein Blatt Pergament mit dem Engelssiegel und folgenden Worten in der bekannten erlesenen Handschrift:
Lieber David,
ich wollte der Erste sein, der Sie in diesem neuen Abschnitt Ihrer Karriere beglückwünscht. Ich habe die Lektüre der ersten Folgen von Die Stadt der Verdammten außerordentlich genossen. Ich baue darauf, dass Ihnen dieses kleine Geschenk zusagt.
Noch einmal drücke ich Ihnen hiermit meine Bewunderung aus und den Wunsch, dass sich eines Tages unsere Wege kreuzen. In der Gewissheit, dass dem so sein wird, grüßt Sie herzlich Ihr Freund und Leser
Andreas Corelli
Das Geschenk bestand in dem Exemplar der Großen Erwartungen , das mir Señor Sempere in meiner Kindheit erst geschenkt und das ich ihm dann zurückgegeben hatte, bevor mein Vater es finden konnte, demselben, das an dem Tag, da ich es nach Jahren zu jedem Preis zurückkaufen wollte, in den Händen eines Fremden verschwunden war. Ich betrachtete den Block Papier, der für mich vor nicht allzu langer Zeit die ganze Magie und alles Licht der Welt enthalten hatte. Auf dem Deckel waren noch die Flecken von meinem Blut zu sehen. »Danke«, murmelte ich.
Señor Sempere setzte seine Präzisionsbrille auf, um das Buch zu untersuchen. Auf seinem Schreibtisch im Hinterzimmer bettete er es auf ein Tuch und richtete das Licht der Bogenlampe darauf. Seine fachkundige Analyse dauerte mehrere Minuten. Andächtig schweigend, schaute ich zu, wie er die Seiten wendete und beschnupperte, mit den Fingern über das Papier und den Rücken strich, das Buch in der einen und dann in der anderen Hand abwog, schließlich den Deckel zuklappte und mit einer Lupe die Blutflecken untersuchte, die meine Finger zwölf oder dreizehn Jahre zuvor hinterlassen hatten.
»Unglaublich«, flüsterte er und nahm die Brille ab. »Es ist dasselbe Buch. Was haben Sie gesagt, wie Sie es zurückbekommen haben?«
»Ich weiß es selber nicht. Señor Sempere, was wissen Sie von einem französischen Verleger namens Andreas Corelli?«
»Zunächst einmal klingt das eher italienisch als französisch, Andreas freilich scheint griechisch zu sein…«
»Der Verlag sitzt in Paris. Éditions de la Lumière.«
Sempere dachte einige Augenblicke nach und zögerte.
»Ich fürchte, das sagt mir nichts. Ich werde Barceló fragen, der weiß alles. Vielleicht kann er weiterhelfen.«
Gustavo Barceló war einer der Doyens der Barceloneser Antiquarenzunft, und sein enzyklopädisches Wissen war ebenso legendär wie sein etwas grantiger, pedantischer Charakter. Unter Fachleuten konsultierte man im Zweifelsfall Barceló. In diesem Augenblick steckte Semperes Sohn, der zwar zwei oder drei Jahre älter war als ich, aber nach wie vor so schüchtern, dass er sich manchmal regelrecht unsichtbar machte, den Kopf herein und gab seinem Vater ein Zeichen.
»Vater, da holt jemand eine Bestellung ab, die, glaube ich, Sie aufgenommen haben.«
Der Buchhändler nickte und reichte mir einen dicken, rundum abgegriffenen Band.
»Das ist das jüngste Gesamtverzeichnis der europäischen Verleger. Schauen Sie doch inzwischen schon mal, ob Sie was finden.«
Ich blieb im Hinterzimmer allein und suchte vergeblich die Éditions de la Lumière, während Sempere vorn bediente. Beim Durchblättern des Kataloges hörte ich eine Frauenstimme mit ihm sprechen, die mir vertraut vorkam. Als der Name Pedro Vidal fiel, schaute ich neugierig hinüber.
Читать дальше