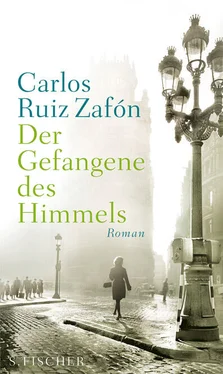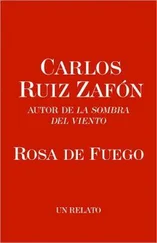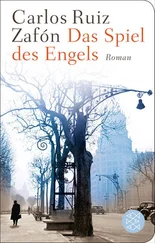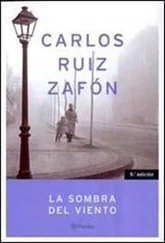»Isabella?«, hörte ich ihn sagen.
Ich befürchtete, der Alkohol trübe ihm weiterhin den Verstand und gleich werde er auf offener Straße zusammenbrechen, und ging einige Schritte voraus. Da sah ich sie.
Sie war bestimmt nicht älter als siebzehn. Im Licht der Straßenlaterne lächelte sie schüchtern und deutete mit der Hand einen Gruß an.
»Ich bin Sofía«, sagte sie mit leichtem Akzent.
Mein Vater starrte sie sprachlos an, als habe er ein Gespenst gesehen. Ich schluckte und spürte, wie mir ein Schauer den Rücken hinunterlief. Dieses junge Mädchen war das lebende Ebenbild meiner Mutter, wie sie auf den Fotos im Sekretär meines Vaters zu sehen war.
»Ich bin Sofía«, wiederholte sie verwirrt. »Ihre Nichte. Aus Neapel…«
»Sofía«, stotterte mein Vater. »Ah, Sofía.«
Die Vorsehung wollte, dass Fermín bei uns war und die Zügel in die Hand nehmen konnte. Nachdem er mich mit einem Klaps aus dem Schrecken geweckt hatte, begann er dem jungen Mädchen auseinanderzusetzen, dass Señor Sempere ein klein wenig unpässlich sei.
»Wir kommen nämlich von einer Weinprobe, und der Ärmste wird schon nach einem Glas Vichywasser schläfrig. Beachten Sie ihn einfach nicht, Signorina, normalerweise wirkt er nicht so verdattert.«
Wir fanden die Eildepesche, die uns die Mutter des Mädchens, Tante Laura, geschickt und worin sie ihr Kommen angekündigt hatte; sie war während unserer Abwesenheit unter der Haustür durchgeschoben worden.
Oben in der Wohnung bettete Fermín meinen Vater aufs Sofa und hieß mich eine Kanne starken Kaffee machen. Inzwischen unterhielt er sich mit dem jungen Mädchen, erkundigte sich nach der Reise und warf allerhand Belanglosigkeiten hin, während mein Vater langsam ins Leben zurückkehrte.
Anmutig und mit einem charmanten Akzent erzählte uns Sofía, sie sei abends um zehn im Francia-Bahnhof angekommen. Dort habe sie ein Taxi zur Plaza de Cataluña genommen. Da niemand zu Hause gewesen sei, habe sie in einer nahen Kneipe Zuflucht gesucht, bis sie geschlossen habe. Danach habe sie sich zum Warten in den Hauseingang gesetzt und gehofft, irgendwann werde schon jemand kommen. Mein Vater erinnerte sich zwar an den Brief, in dem ihre Mutter ihr Eintreffen angekündigt hatte, aber so bald habe er sie nicht erwartet.
»Es tut mir sehr leid, dass du auf der Straße hast ausharren müssen«, sagte er. »Sonst gehe ich nie aus, aber heute war Fermíns Junggesellenabschied…«
Sofía war entzückt von der Nachricht, und sie stand auf, um Fermín einen Kuss auf die Stirn zu drücken. Der hatte sich zwar aus dem Kampfgetümmel zurückgezogen, konnte jedoch dem Impuls nicht widerstehen, sie auf der Stelle zur Hochzeit einzuladen.
Als wir eine halbe Stunde geplaudert hatten, kam Bea vom Junggesellinnenabschied der Bernarda zurück, hörte im Treppenhaus Stimmen aus der Wohnung und klopfte an. Beim Betreten des Esszimmers erblickte sie Sofía, wurde weiß und warf mir einen Blick zu.
»Das ist meine Cousine Sofía aus Neapel«, verkündete ich. »Sie ist zum Studieren nach Barcelona gekommen und wird eine Zeitlang hier wohnen…«
Bea versuchte ihre Beunruhigung zu verbergen und begrüßte sie vollkommen unbefangen.
»Das ist meine Frau Beatriz.«
»Bea, bitte. Keiner nennt mich Beatriz.«
Zeit und Kaffee machten Sofías Anwesenheit allmählich zur Selbstverständlichkeit, und nach einer Weile fand Bea, die Arme sei bestimmt erschöpft und gehe wohl am besten schlafen, morgen sei auch wieder ein Tag, wenn auch ein Hochzeitstag. Es wurde beschlossen, sie in meinem ehemaligen Kinderzimmer unterzubringen, und nachdem er sich vergewissert hatte, dass mein Vater nicht erneut ins Koma fallen würde, brachte Fermín ihn ebenfalls zu Bett. Bea versicherte Sofía, sie werde ihr für die Zeremonie eins ihrer Kleider überlassen, und als Fermín, dem man den Rum aus zwei Meter Entfernung anroch, eine unangebrachte Bemerkung über Ähnlichkeit und Verschiedenheit von Figur und Kleidergrößen machen wollte, brachte ich ihn mit dem Ellbogen zum Schweigen.
Von der Konsole her betrachtete uns ein Hochzeitsfoto meiner Eltern. Wir saßen zu dritt im Esszimmer und schauten es an und konnten uns nicht von unserem Staunen erholen.
»Wie ein Ei dem anderen«, murmelte Fermín.
Bea sah mich von der Seite an und versuchte meine Gedanken zu erraten. Sie nahm meine Hand und machte ein heiteres Gesicht, um das Gespräch in andere Bahnen zu lenken.
»Na, wie war denn das Gelage?«, fragte sie.
»Züchtig«, versicherte Fermín. »Und das der Damen?«
»Keine Spur von züchtig.«
Fermín sah mich ernst an.
»Ich sag ja immer, in solchen Dingen sind Frauen sehr viel ausschweifender als wir.«
Bea lächelte rätselhaft.
»Wen nennen Sie ausschweifend, Fermín?«
»Verzeihen Sie den unverzeihlichen Ausrutscher, Doña Beatriz, da spricht der Rum mit Zitrone, der in meinen Adern fließt und mich Unsinn reden lässt. Sie sind bei Gott ein Muster an Tugend und Feinheit, und meine Unbedeutendheit möchte eher verstummen und die restlichen Tage wortlos büßend in einer Kartäuserzelle verbringen, als auch nur von fern den Anschein von Ausschweiflichkeit Ihrerseits anzudeuten.«
»Daraus wird nichts«, sagte ich.
»Lassen wir das Thema besser«, fiel uns Bea ins Wort und sah uns an wie zwei Lausebengel. »Und jetzt werdet ihr ja vermutlich den traditionellen Vorhochzeitsspaziergang auf den Wellenbrecher unternehmen.«
Fermín und ich schauten uns an.
»Los, geht schon. Ich würde euch raten, morgen pünktlich in der Kirche zu erscheinen…«
Das einzige Lokal, das zu dieser Stunde noch aufhatte, war das Xampanyet in der Calle Montcada. Offenbar riefen wir einen äußerst bemitleidenswerten Eindruck hervor, denn man ließ uns eine Weile bleiben, während saubergemacht wurde. Beim Schließen drückte der Wirt Fermín angesichts der Nachricht, dass er in wenigen Stunden ein verheirateter Mann wäre, sein Beileid aus und schenkte uns eine Flasche der hauseigenen Medizin.
»Augen zu und durch!«, riet er.
Wir streiften durch die Gassen des Viertels und hämmerten wie immer die Welt zurecht, bis sich der Himmel zage purpurn färbte — Zeit, dass der Bräutigam und sein Trauzeuge, also ich, sich auf den Wellenbrecher setzten, um einmal mehr vor der größten Fata Morgana der Welt die Morgendämmerung zu begrüßen, vor dem Barcelona, das sich beim Aufwachen im Hafenwasser spiegelte.
Die Beine von der Mole baumeln lassend, tranken wir aus der Flasche, die man uns im Xampanyet geschenkt hatte. Zwischen zwei Schlucken betrachteten wir schweigend die Stadt und verfolgten den Flug eines Möwenschwarms über der Kuppel der Mercè-Kirche, der dann einen Bogen zwischen den Türmen des Postgebäudes zeichnete. In der Ferne erhob sich auf dem Montjuïc düster das Kastell wie ein geisterhafter Vogel, lauernd die Stadt zu seinen Füßen beobachtend.
Das Nebelhorn eines Schiffs durchbrach die Stille, und wir sahen auf der anderen Seite des nationalen Hafenbeckens einen großen Kreuzer die Anker lichten, um in See zu stechen. Das Schiff löste sich von der Mole und drehte mit einem Propellerschub, der im Hafenwasser eine breite Kielspur hinterließ, den Bug der Hafeneinfahrt zu. Dutzende Passagiere waren an Deck gekommen und winkten. Ich fragte mich, ob sich unter ihnen auch die Rociíto und ihr schmucker rüstiger Schrotthändler aus Reus befanden. Nachdenklich schaute Fermín dem Schiff nach.
»Glauben Sie, die Rociíto wird glücklich werden, Daniel?«
»Und Sie, Fermín? Werden Sie glücklich sein?«
Wir sahen, wie sich das Schiff entfernte und die Gestalten immer kleiner und dann unsichtbar wurden.
»Fermín, da gibt es etwas, was ich gern wüsste. Warum hat Ihnen niemand ein Hochzeitsgeschenk machen dürfen?«
Читать дальше