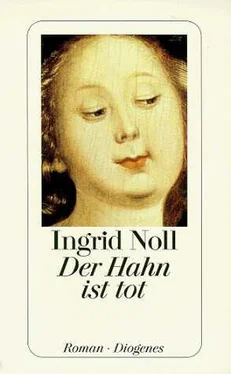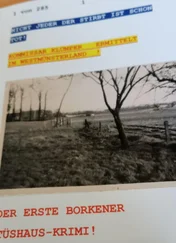»Von woher rufst du an?« fragte ich ängstlich.
Witold lachte jetzt. »Meine Komplizin ist ein Angsthase. Ich rufe nicht von zu Hause an, versteht sich. Also dann, wir sehen uns auf der Beerdigung. Tschüs, Thyra.«
In den nächsten Tagen dachte ich manchmal darüber nach, ob ich jetzt Vivian umbringen sollte. Aber ich verwarf diesen Gedanken. Erstens wollte ich überhaupt nie wieder jemanden ermorden, weil ich einfach nicht die Nerven dazu hatte.
Zweitens versprach ich dem Geist meiner toten Freundin, mit dem ich nachts häufig Zwiesprache hielt? ihre Kinder nicht anzurühren. Und drittens: Wie sollte ich es überhaupt anstellen? Den Revolver durfte ich nicht mehr benutzen.
Vivian und ich hatten eine distanziert-höfliche Beziehung (genau genommen mochten wir einander nicht), nie hätte ich sie irgendwohin locken können.
Witold liebte sie und sie ihn, so sagte er. Aber das war reine Illusion. Vivian war flatterhaft, über kurz oder lang hatte sie einen anderen, und Witold würde leiden. Wer konnte ihn dann besser trösten als ich? Schließlich wußte ich viel über ihn, das hatte er selbst gesagt, und er wollte ja auch seine Freunde in diese neue Liebschaft noch nicht einweihen.
Es bestand also kein Grund zum Verzweifeln. Niemand verdächtigte mich, und dem Ziel meiner Bemühungen war ich ein ganzes Stückchen näher gekommen.
Mich erreichte die Todesanzeige. Beates Vater und ihre Kinder, Geschwister und Freunde trauerten um sie; der Exmann war nicht aufgeführt, obgleich er doch die Anzeige aufgesetzt hatte.
Zur Beerdigung bestellte ich einen kleinen Kranz aus blauen Blumen (Beates Lieblingsfarbe): Rittersporn, Eisenhut, Kornblumen, Iris und einige blau eingefärbte Margeriten. Er sah wie ein Hochzeitskranz aus, dachte ich, nicht wie ein Totenkränzlein.
Ich selbst war zurückhaltend aufgemacht; schwarz mußte sein, Lippenstift und Rouge vermied ich. Mein Selbstbewußtsein war geschrumpft, ängstlich und schüchtern versuchte ich, weder zu früh noch zu spät auf dem Friedhof zu erscheinen.
Es war eine riesengroße Beerdigung, was ich nicht erwartet hatte. Die Autos standen auf beiden Seiten der Straße, weil sie auf dem Parkplatz nicht unterkamen.
Auf dem Weg zum Portal rief man hinter mir meinen Namen: »Hallo, Rosi, warte doch!«
Ich duze mich mit sehr wenigen Menschen, in meinem Mannheimer Büro mit niemandem, obgleich sie mich deswegen für schrullig halten. Aber diese Mode des Duzens am Arbeitsplatz habe ich aus tiefer Überzeugung abgelehnt.
Verwandte habe ich keine und auch kaum Freunde zum Duzen.
Beate, ja, die kannte ich seit meiner Kindheit, und auch ihre Kinder hatten mich, ohne lange zu fragen, »Rosi« genannt, nicht aber Beates früherer Mann; neulich mal wieder Hartmut aus Berlin — ihn konnte ich wohl oder übel nicht gut siezen; Witold — Gott sei Dank! — und quasi aus Zufall noch sein Freund Dr. Schröder. Sonst gab es keinen, dachte ich. Aber aus der schwarzströmenden Trauergemeinde löste sich doch eine mir flüchtig bekannte Gestalt, die »du« zu mir sagte: Beates letzter Freund, Jürgen Faltermann. Tatsächlich hatte er mir das Du bei unserer einzigen Begegnung regelrecht aufgezwungen.
Ich dachte damals, ich würde ihn wahrscheinlich kaum je wieder treffen und wollte auch nicht gar so zickig sein. Nun war er neben mir.
»Rosi, ich wollte dich schon seit Tagen anrufen, aber ich habe leider deinen Familiennamen vergessen.«
Er war mir viel zu distanzlos.
»Hirte«, sagte ich mit müder Kälte.
»Ach ja, genau! Hirte! Aber ist jetzt egal. Hast du hinterher ein bißchen Zeit, ich muß unbedingt mit dir sprechen.«
»Wenn’s denn sein muß«, sagte ich ziemlich unfreundlich, aber er erwiderte nur: »Also, dann warte hier am Haupteingang.«
Wir schoben uns in die kleine Kapelle, und ich suchte einen Platz im Hintergrund, während Jürgen sich in der Mitte niederließ.
Beate war früher gemeinsam mit ihrem Mann aus der Kirche ausgetreten, erinnerte ich mich. Ob nun trotzdem von einem Pfarrer eine Rede gehalten wurde?
Vorn saß Beates Vater, alt und gebrochen, neben ihm Lessi.
Er hielt ihre Hand. Dann folgten Richard, Vivian und Beates Geschwister mit ihren Familien, in den Reihen dahinter entferntere Verwandtschaft, auch Beates früherer Ehemann und eine gewaltige Menge von Freunden und Bekannten, unter denen ich auch Witold entdeckte. Neben ihm saß aus purem Zufall — ich erkannte sie nach einem Foto — die neue Frau Sperber, Beates Nachfolgerin, mit ihrer Tochter, also einer Halbschwester von Beates Kindern.
Die Rede wurde von Beates Schwager gehalten, einem Professor aus Hamburg. Er sprach geistreich und gekonnt, schilderte ihr Leben und lobte ihre vielen guten Eigenschaften.
Aber seine kalte und eher geschäftsmäßige Ansprache löste bei den Zuhörern keine Emotionen aus; man hustete, scharrte, schneuzte auch vereinzelt, flüsterte.
Als er fertig war, entstand eine kurze Pause. Dann rauschte es an der Tür, und etwa zwanzig gestandene Männer in einheitlicher Kleidung traten ein. Der betagte Vater, der sein Leben lang Mitglied im Männergesangverein gewesen war, hatte diese trefflichen Herren hergebeten. Anscheinend war ihm eine Trauerfeier ohne Pfarrer und Gebete zu kalt erschienen, und nun hatte er für beispielhafte Stimmung gesorgt. Die alten Sänger legten die linke Hand auf den Rücken, stellten ein Bein vor und sangen auswendig: »Ich bete an die Macht der Liebe!«, wobei sie abrupt vom Porte ins Pianissimo rutschten und mühelos wieder zurück. Obgleich ich, wie schon betont, von Musik wenig Ahnung habe, hörte ich schon bei den ersten Tönen, daß dies hier Kitsch war. Was dem Redner nicht geglückt war, den Sängern gelang es auf Anhieb: Ein heilloses Schluchzen setzte ein, alt und jung konnten sich nicht mehr beherrschen, die vielen Menschen vereinten sich endlich zu einer Gemeinschaft der Weinenden.
Die Künstler, die diesen Erfolg erwartet hatten, ließen sich nicht lumpen und sorgten dafür, daß der Strom nicht so schnell versiegte.
Stolz durchflutete mich: Mir und diesen Trauersängern war es gelungen, so viele unterschiedliche Menschen in einem großen Gefühl zu vereinen. Ohne mich wäre diese unvergeßliche Feier nie zustande gekommen.
Mein Hochgefühl hielt an, bis ich Jürgen Faltermann traf.
Ich konnte ihn nicht leiden, was nicht zuletzt damit zu tun hatte, daß er mich so ungehemmt »Rosi« nannte.
»Gehen wir einen trinken«, sagte er gleich, »ich habe keine Lust, von der ganzen Mischpoke angegafft zu werden.« Er schwitzt wie Hartmut, dachte ich angewidert.
Wir saßen in einem billigen Speiselokal, in dem es penetrant nach Fritten roch. Jürgen bestellte Bier, ich Mineralwasser, er Schnitzel mit Salat, ich eine Königinpastete.
Jürgen goß das Bier in die Kehle. Er zog sein Jackett aus und saß mir nun in einem ungelüfteten schwarzen Rollkragenpullover aus Synthetic gegenüber.
»Kommen wir doch gleich zur Sache«, begann er und beobachtete scharf die Tür. Aber andere Trauergäste schienen sich nicht hierher zu verirren. Ich sah ihn fragend an.
»Die Polypen löchern mich pausenlos. Dabei bin ich am betreffenden Wochenende brav bei Weib und Kind in München gewesen. Ich habe eine Quittung von einer Autobahntankstelle vom Sonntag abend, aber das nützt mir nicht sehr viel. Ich kann nicht beweisen, daß ich schon Freitag nachmittag von hier losgefahren bin. In München hat mich am Samstag kein Schwein gesehen, außer meiner Frau. Die kleinen Kinder zählen sowieso nicht. Das Auto stand in der Garage. Es war zwar schönes Wetter, aber ich Idiot habe am Samstag nur zu Hause gehockt und meine Buchführung gemacht.«
Er ergriff die Plastikblume aus dem Tischväschen und zerlegte sie.
Ich wollte gerade fragen, was mich das anginge, da kamen schon seine Vorwürfe: »Du mußt den Bullen diesen Blödsinn erzählt haben, daß die Beate in den Typ von der Vivian, den eingebildeten Lehrer, verliebt war. Wie kommst du überhaupt dazu, so eine Lüge zu verbreiten?«
Читать дальше