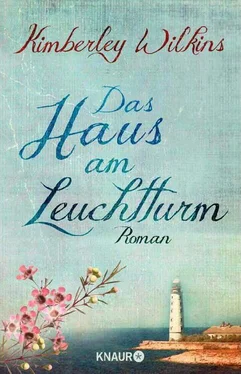Als sie sie wieder öffnete, war der Fischer verschwunden, und es war Abend geworden. Sie stand auf und klopfte sich den Sand ab, bevor sie zum Cottage zurückschlenderte. Der Strand war durch einen Grünstreifen von der Zivilisation getrennt: Banksien, Schraubenbäume, Mangroven. Geisterkrabben huschten davon, als sie den Sandweg zur Straße hinaufging. Im Cottage stellte sie erfreut fest, dass der muffige Geruch verschwunden war. Die Meeresbrise strömte durch die Fenster herein und ließ die zarten Spitzengardinen flattern. Sie machte sich ein Sandwich mit Erdnussbutter, spülte das Salz unter kaltem Wasser ab und spielte mit dem Gedanken, eine Leinwand vorzubereiten und einige Farbtuben zu öffnen. Doch ihre Müdigkeit war größer, und sie legte sich stattdessen ins Bett.
Gegen elf wachte sie auf und fragte sich, was sie aus dem Schlaf gerissen hatte. Ein Automotor. Sie lag im Dunkeln und horchte. Der Wagen schien im Leerlauf zu warten.
Sie stand auf und zog den Vorhang beiseite. Tatsächlich, auf der Straße vor ihrem Haus stand ein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern und laufendem Motor. Bewegungslos. Libby schaute neugierig hinaus. Spürte ein ängstliches Kribbeln. Es war zu dunkel, um den Wagen zu erkennen, geschweige denn das Nummernschild. Fünf Minuten vergingen. Zehn. Dann schließlich fuhr er los, wendete und schoss dröhnend davon, dass der Kies am Straßenrand nur so spritzte.
Es war nicht der ideale Tag für eine Mutter-Kind-Gruppe. Cheryl hatte sich um sieben Uhr krankgemeldet, und Juliet hatte Melody noch nicht erreicht, um zu fragen, ob sie früher kommen konnte. Vielleicht könnte sie die Teestube bis Mittag, wenn Melody zum Dienst kam, allein bewältigen, sofern sie die schmutzige Wäsche in Zimmer 2 warten ließ. Nach dem Mittagessen könnte sie rasch nach oben laufen, die Betten frisch beziehen und das einzige vermietete Zimmer staubsaugen. Dann wäre sie bereit für die Nachmittagsgäste. So funktionierte es allerdings nur an einem normalen Morgen.
»Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus«, sagte die junge Frau mit dem runden Gesicht und dem ebenso rundgesichtigen Baby auf der Hüfte, »wir wollten uns eigentlich bei mir treffen. Leider hatte ich vergessen, dass die Handwerker heute kommen, um einen neuen Wäscheschrank aufzubauen. Das ist einfach zu laut.«
»Natürlich macht es mir nichts aus«, erwiderte Juliet und stellte im Kopf hektisch Berechnungen an. Es waren insgesamt zwölf Frauen. Selbst wenn jede von ihnen Scones mit Erdbeermarmelade und Rahm bestellte, blieben immer noch vierzehn Scones für die Stammgäste übrig. Sollte sie schon jetzt neuen Teig anrühren? Bevor alle zehn verschiedene Arten Kaffee bestellten und ihre Babyflaschen aufgewärmt haben wollten?
Schon kamen die Bestellungen herein, und Juliet eilte geschickt und anmutig zwischen Tischen und Küche hin und her und warf dabei einen betrübten Blick auf die vier ungeöffneten Toastpackungen, aus denen sie eigentlich die Sandwiches für die Mittagszeit zubereiten wollte. Der heutige Tag würde ein Alptraum werden. Augen zu und durch, anders ging es nicht. Zum Glück war Juliet harte Arbeit gewohnt. Sie band die langen, braunen Haare nach hinten und legte los.
Juliet‘s B & B und Teestube oder einfach Juliet‘s verdankte seinen Erfolg der günstigen Lage: unmittelbar am Strand gelegen, mit einer breiten, überdachten Holzterrasse, auf der Kleinkinder Möwen füttern und gehetzte Mütter ihre müden Augen mit einem Blick aufs Meer entspannen konnten. Doch der Erfolg stand und fiel mit Juliet. »Sie ist ein wahres Wunder«, hörte sie die Leute oft sagen. Manchmal sagten sie auch: »Sie ist mit ihrem Job verheiratet.« Allerdings erst nachdem sie die Annäherungsversuche von Sergeant Scott Lacey, dem früheren Unruhestifter der Bay High und jetzigen Ortspolizisten, zurückgewiesen hatte. Doch Juliet war weder ein Wunder noch mit ihrem Job verheiratet. Als ihr Vater vor fünfzehn Jahren starb, hatte er ihr das Geschäft hinterlassen, irgendjemand musste ja die Zügel in die Hand nehmen. Sie war erst dreiundzwanzig gewesen, wusste aber, dass das Lebenswerk ihres Vaters nicht vor die Hunde gehen durfte. Sie hatte die Teestube eröffnet, den Namen Juliet‘s außen angebracht und seitdem nicht einen einzigen Tag Urlaub gehabt. Selbst als sie drei Wochen in einem Meditationszentrum in Neuseeland verbracht hatte, hatte sie Cheryl täglich angerufen, um sich einen Lagebericht geben zu lassen, Probleme zu lösen und die enorme Aufgabenliste zu erweitern, die sie nach ihrer Rückkehr abarbeiten musste.
Um halb zwölf räumte Melody gerade die Tische auf der Terrasse ab, während Juliet im Eiltempo Sandwiches schmierte und das Telefon im Hintergrund endlos klingelte. Dann läutete es an der Tür. Juliet dachte nur: Bitte nicht noch mehr Gäste. Gib mir nur zehn Minuten, bis ich diese Sandwiches fertig habe.
Doch dann trat Melody in die Küchentür. »Du hast Besuch.«
Juliet blickte auf, wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und schob sich eine Haarsträhne aus den Augen. »Wen denn?«
»Sie sagt, sie heißt Libby.«
Trotz der stickigen Wärme, die in der Küche herrschte, wurde Juliet eiskalt. »Nein. Bist du dir sicher?«
»Das hat sie jedenfalls gesagt«, antwortete Melody argwöhnisch. »Alles in Ordnung?«
Juliet fluchte nie. Nicht weil sie prüde gewesen wäre, nur wurden solche Worte oft derart zornig und heftig ausgesprochen, dass sie innerlich zusammenzuckte. Jetzt aber legte sie das Buttermesser hin, drückte die Handflächen auf die Arbeitsplatte aus Edelstahl und brüllte: »Verdammte Scheiße!«
Melody war erst neunzehn und wich, mehr erschreckt als verwirrt, vor ihr zurück. »Schon gut, ich sage, du bist zu beschäftigt.«
Juliet nahm die Schürze ab. »Nein, nein. Ich komme. Sie ist meine Schwester. Ich habe sie seit zwanzig Jahren nicht gesehen.« Ihr Herz schlug schneller. Zwanzig Jahre. Nicht seit … Juliet schüttelte den Kopf. »Hier«, sie reichte Melody die Schürze. »Du machst vier mit Schinken und Salat, vier mit Truthahn, Emmentaler und Cranberries und vier … Ach, lass dir was einfallen. Wo ist sie?«
»Auf der Terrasse. Ich bin noch nicht fertig mit Aufräumen, seit die Krabbelgruppe gegangen ist.«
Juliet schluckte mühsam. Ihr Mund war trocken. Sie ging nach draußen auf die Terrasse. Libby saß mit dem Rücken zu ihr, ihr schwarzes Haar glänzte in der Sonne. Sie trug ein ärmelloses, dunkelblaues Kleid, das einen starken Kontrast zu ihrer Elfenbeinhaut bildete. Juliet betastete unsicher ihr verschwitztes Haar. Die Tische waren voll mit schmutzigem Geschirr. Die Möwen taten sich an den halb zerkauten Resten gütlich, die die Kleinkinder hatten fallen lassen. Juliet verscheuchte sie.
Libby drehte sich um. »Juliet.« Sie sprang auf.
»Ich hatte nicht mit dir gerechnet.« Klang das zu kalt? Hätte sie sagen sollen: »Ich freue mich, dich zu sehen?« Freute sie sich denn wirklich , ihre Schwester zu sehen – nach zwanzig Jahren und acht Weihnachtskarten, die immer erst im Februar angekommen waren? Nein, eigentlich wollte sie fragen: »Was machst du hier«? Plötzlich bekam sie Angst, dass Libby ihren Anteil am Geschäft einfordern würde, das ihr Vater ihnen beiden vermacht hatte.
»Es tut mir leid«, sagte Libby mit dem gewinnenden Lächeln, das die Herzen der Jungen an der Bay High hatte höherschlagen lassen. Aller Jungen außer Andy. Sie breitete die Hände aus. »Jetlag. Ich kann nicht klar denken. Ich hätte vorher anrufen sollen.«
»Ich habe Zimmer frei, aber sie sind noch nicht fertig. Heute Morgen war furchtbar viel zu tun und …«
»Ich brauche kein Zimmer. Alles in Ordnung.«
»Wo willst du denn wohnen?« Wenn ihre Schwester eine Ferienwohnung gebucht hätte, hätte sie gewiss davon erfahren.
Читать дальше