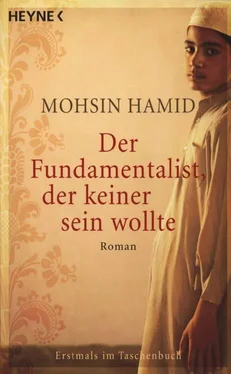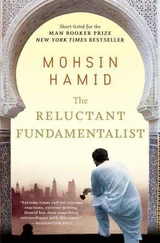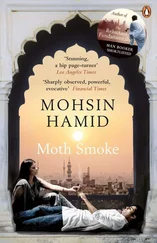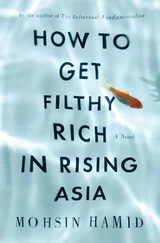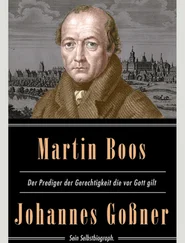Am nächsten Tag kam ich zum ersten Mal zu spät zur Arbeit. Ich hatte verschlafen und erwachte mit hämmernden Kopfschmerzen. Meine Wut hatte nachgelassen, doch sosehr ich mir einredete, ich hätte mir das alles nur eingebildet – einer solch gründlichen Selbsttäuschung war ich nicht mehr fähig. Immerhin sagte ich mir, ich hätte überreagiert, ich könne ja ohnehin nichts tun, und diese ganzen Weltereignisse spielten sich auf einer Bühne ab, die für mein persönliches Leben ohne Bedeutung sei. Doch ich merkte, wie die Glut weiterhin in mir glomm, und an dem Tag hatte ich Schwierigkeiten, mich auf die Fundamentals zu konzentrieren, was mir normalerweise so gut gelang.
Aber da! Haben Sie das gehört, Sir, dieses gedämpfte Grollen wie von einem jungen Löwen, der in einem Jutesack gefangen gehalten wird? Das war mein Magen, der dagegen protestiert, dass er nichts zu essen bekommt. Wollen wir nicht unser Abendessen bestellen? Sie möchten lieber warten und bei Ihrer Rückkehr im Hotel essen? Aber ich bestehe darauf! Eine solch authentische Einführung in die Cuisine Lahores dürfen Sie sich nicht entgehen lassen; sie wird mit den Gerichten, für die dieser Markt zu Recht bekannt ist, ein rein karnivores Festmahl werden – da aus einer Zeit, als das Wissen um Cholesterin den Menschen noch keine Angst vor seiner Beute einflößte – und darum desto köstlicher sein.
Vielleicht weil es uns gegenwärtig an Reichtum, Macht oder auch nur – ungeachtet gelegentlich hervorragender Leistungen unseres Kricket-Teams – sportlichem Ruhm mangelt, wie es unserem Status als dem Land mit der sechstgrößten Bevölkerung entspräche, legen wir Pakistani auf unser Essen außerordentlichen Wert. Hier in Alt-Anarkali besteht er in der Reinheit der dargebotenen Kost; kein einziger dieser würdigen Gastwirte würde es auch nur in Erwägung ziehen, ein westliches Gericht auf die Speisekarte zu setzen. Nein, wir sind vielmehr umgeben von Kebab vom Lamm, dem Tikka vom Huhn, dem gedämpften Fuß der Ziege, dem scharf gewürzten Hirn des Schafs! Das, Sir, sind Köstlichkeiten des Jägers , Köstlichkeiten, durchtränkt von einem Hauch Luxus und wollüstiger Hingabe. Wir haben nichts übrig für die vegetarischen Rezepte, die man jenseits der Grenze im Osten findet, auch nicht für das sterilisierte, behandelte Fleisch, das in Ihrer Heimat so verbreitet ist! Hier sind wir nicht so zimperlich, wenn es darum geht, uns den Folgen unseres Appetits zu stellen.
Denn wir waren nicht immer mit Schulden belastet, von ausländischen Leistungen und von Almosen abhängig; in den Geschichten, die wir über uns erzählen, sind wir nicht die wahnsinnigen und verarmten Radikalen, die Sie auf Ihren Fernsehkanälen sehen, sondern Heilige und Dichter und – jawohl – siegreiche Könige. Wir haben die Königliche Moschee erbaut und die Shalimar-Gärten in dieser Stadt angelegt, wir haben das Lahore-Fort errichtet, mit seinen mächtigen Mauern und der breiten Rampe für unsere Kampfelefanten. Und als wir das alles erschufen, war Ihr Land noch eine Ansammlung dreizehn kleiner Kolonien, die am Rande eines Kontinents ihr Dasein fristeten.
Aber ich werde schon wieder laut und bereite Ihnen zudem erhebliches Unbehagen. Bitte entschuldigen Sie; es wat nicht meine Absicht, grob zu sein. Außerdem sollte ich Ihnen doch erklären, warum ich mit Erica nicht über meine Wut anlässlich des Einmarschs amerikanischer Truppen in Afghanistan sprach. Nach jener Nacht, in der wir in meinem Bett feierten, dass sie einen Agenten gefunden hatte, gab es mehrere Tage lang keinen Kontakt mit Erica; sie nahm nicht ab, wenn ich anrief, und antwortete nicht auf meine Nachrichten. Dieses Verhalten verletzte mich – ich nahm ihr Schweigen als Rücksichtslosigkeit –, und als sie sich dann doch mit mir in einer Bar verabredete, ging ich mit reichlich Vorwürfen im Bauch hin. Was ich dann sah, traf mich völlig unvorbereitet.
Am Tresen stand eine reduzierte Erica, nicht die lebhafte, selbstsichere Frau, die ich kannte, sondern ein blasses, nervöses Wesen, das mir fast fremd war. Sie schien abgenommen zu haben, und ihre Blicke zuckten durchs Lokal. Erst als sie lächelte, erstrahlte etwas von der alten Erica, doch das Lächeln wich so schnell aus ihrem Gesicht, wie es gekommen war. Meine Bestürzung muss wohl deutlich gewesen sein, denn sie lächelte wieder und sagte: »Sehe ich so schlimm aus?« »Überhaupt nicht«, log ich. »Etwas müde vielleicht. Geht’s dir nicht gut?« »Nein«, sagte sie. »Tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe.« »Ist schon in Ordnung«, sagte ich. »Ich hoffe nur, dass ich dich nicht genervt habe.« »Du nervst nie«, sagte sie. »Ich hatte eine ziemlich schlimme Phase. Es war nicht die erste. Aber so heftig war es seit Chris’ Tod nicht mehr.«
Wir bestellten, Bier für mich und eine Flasche Wasser für sie, und ich erwog, sie in den Arm zu nehmen, entschied mich aber dagegen; sie wirkte zu zerbrechlich für eine Berührung. »Es ist so«, fuhr sie fort, »dass alles in meinem Kopf kreist, es denkt und denkt, und dann kann ich nicht schlafen. Und wenn du ein paar Tage nicht geschlafen hast, wirst du krank. Du kannst nicht mehr essen. Du fängst an zu weinen. Das kriegt dann so eine Eigendynamik. Mein Arzt hat mir ein stärkeres Mittel gegeben, mit dem habe ich wieder geschlafen. Aber es ist kein richtiger Schlaf. Und den Rest des Tages habe ich das Gefühl, dass ich vollkommen neben mir stehe. Wie wenn du aus dem Flugzeug steigst und nicht richtig hören kannst. Genau so, nur dass es nicht nur das Gehör ist und ich es nicht freischlucken kann.« Sie trank etwas Wasser und zwinkerte mir bemüht zu. Dann sagte sie: »Schlimm, wie?«
Ich stand schweigend da, und mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können, nicht einmal ein Lächeln brachte ich zustande; ich war entsetzt. Doch sie wartete auf eine Antwort, also sagte ich: »Aber woran denkst du denn, was bringt dich so durcheinander?« »Ich denke viel an Chris«, sagte sie, »und ich denke an mich. Ich denke an mein Buch. Und manchmal habe ich ziemlich düstere Gedanken. Und ich denke an dich.« »Was denkst du«, fragte ich, »wenn du an mich denkst?« »Ich denke, dass es für dich nicht gut ist, wenn du mich jetzt so viel siehst«, antwortete sie. »Ich meine, es ist nicht gut für dich.« »Doch«, versicherte ich ihr, auch wenn ich Angst bekam, »ich will dich aber sehen.« »Genau das meine ich ja«, sagte sie und sah mir sehr ernst in die Augen. »Verstehst du? Genau das meine ich.«
Ich verstand es nicht im Mindesten, und ich bat sie, mit zu mir zu kommen. »Ich glaube, das sollte ich nicht tun«, sagte sie, »wirklich.« Doch in ihrem Ausdruck lag etwas Weiches, und als ich weiter darauf beharrte, willigte sie schließlich ein. Während der Fahrt im Taxi mühte sich mein Gehirn ab zu begreifen, was da geschah. Im Verlauf jener letzten Wochen hatte ich mich – das mag nun sentimental und altmodisch klingen, aber schließlich war ich in einer Familie aufgewachsen, wo ein kurzes Werben die Regel war – Tagträumen von einem Leben als Ericas Mann hingegeben; nun merkte ich, dass nicht nur sie, sondern auch die Frau selbst vor meinen Augen verschwand. Ich wollte ihr helfen, an ihr festhalten – ja, an uns festhalten –, und ich wollte sie unbedingt aus dem Gestrüpp ihrer Psychose befreien. Aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte.
In meinem Bett bat sie mich, sie in die Arme zu nehmen; ich tat es und flüsterte ihr leise ins Ohr. Ich wusste, dass ihr meine Geschichten aus Pakistan gefielen, also erzählte ich ihr alles Mögliche von meiner Familie und von Lahore. Als ich sie küssen wollte, blieben ihre Lippen regungslos und sie schloss auch nicht die Augen. Also schloss ich sie für sie und fragte: »Vermisst du Chris?« Sie nickte, und ich sah, wie sich Tränen zwischen ihren Lidern hervorpressten. »Dann tu so«, sagte ich, »tu so, als wäre ich er.« Ich weiß nicht, warum ich das sagte; ich fühlte mich überwältigt, und plötzlich erschien das als ein möglicher Schritt nach vorn. »Was?«, sagte sie, ohne die Augen zu öffnen. »Tu so, als wäre ich er«, wiederholte ich. Und langsam, im Dunkeln und schweigend, taten wir es.
Читать дальше