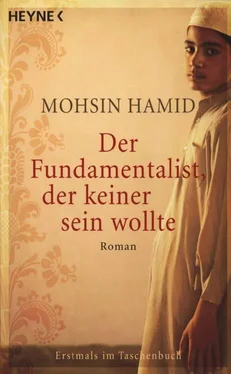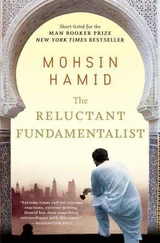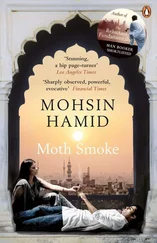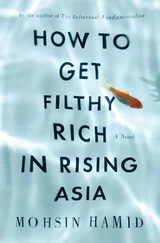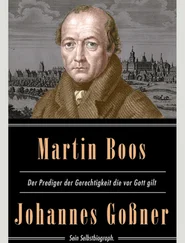Mohsin Hamid
Der Fundamentalist, der keiner sein wollte
Roman
EINE GESCHICHTE VON
UNWIDERSTEHLICHER SOGKRAFT
In einem Straßencafé in Lahore kreuzen sich die Wege des Pakistani Changez und eines schweigsamen Amerikaners. Die beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein, und doch scheint sie etwas zu verbinden. Als langsam die Nacht hereinbricht, enthüllt Changez seine Lebensgeschichte und erzählt, wie er als junger, ehrgeiziger Gaststudent nach Princeton kommt und wie er den »amerikanischen Traum« par excellence erlebt. Noch wähnt er sich auf der Seite der Gewinner. Aber nach dem 11. September gerät sein Weltbild ins Wanken und plötzlich erscheint ihm die Bindung an seine Heimat wichtiger als Geld, Macht und Erfolg. Während sich allmählich Changez’ Lebensweg mit all seinen Konsequenzen abzeichnet, wird die Atmosphäre zwischen dem Pakistani und dem Amerikaner immer beunruhigender. Allein im Spiegel des Erzählers zeichnet sich ab, dass der grausame Höhepunkt der Geschichte kurz bevorsteht.

Mohsin Hamid,geboren 1971, wuchs in Lahore, Pakistan, auf, studierte Jura in Princeton und Harvard und arbeitete in New York. Für seinen ersten Roman Nachtschmetterlinge wurde ihm der Betty-Trask-Preis verliehen, sein Debüt wurde außerdem für den PEN/Hemingway Award nominiert und von der New York Times auf die Liste der bedeutendsten Bücher des Jahres 2000 gewählt. Der Fundamentalist, der keiner sein wollte erhielt 2007 eine Nominierung für den renommierten Man Booker Prize. Hamid schreibt u.a. für Time, Guardian und New York Times. Er lebt in London.
Entschuldigen Sie, Sir, kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, jetzt habe ich Sie erschreckt. Sie brauchen keine Angst vor meinem Bart zu haben: Ich liebe Amerika. Mir ist aufgefallen, dass Sie nach etwas suchten; eigentlich mehr als das, es sah eher danach aus, als seien Sie mit einem Auftrag hier, und da ich in dieser Stadt lebe und Ihre Sprache spreche, habe ich gedacht, ich könnte Ihnen meine Dienste anbieten.
Woher ich gewusst habe, dass Sie Amerikaner sind? Nein, nicht wegen Ihrer Hautfarbe; wir haben eine ganze Palette von Schattierungen in diesem Land, und Ihre findet man häufig bei den Menschen an unserer Nordwestgrenze. Auch Ihre Kleidung hat Sie nicht verraten; jeder europäische Tourist hätte sich so einen Anzug mit Rückenschlitz und ein Button-down-Hemd problemlos in Des Moines beschaffen können. Gut, Ihre kurz geschnittenen Haare und Ihre breite Brust – ich würde sagen, die Brust eines Mannes, der regelmäßig Bankdrücken macht und gut und gern über zwei fünfundzwanzig schafft –, die sind typisch für einen bestimmten Typus Amerikaner, aber auf der anderen Seite: Sehen Sportler und Soldaten aller Nationalitäten nicht irgendwie gleich aus? Vielmehr gestattete mir Ihre Haltung, Sie zu identifizieren, und das meine ich nicht beleidigend – ich sehe, Ihr Gesicht hat sich verhärtet –, es war lediglich eine Beobachtung.
Wollen Sie mir nicht sagen, wonach Sie gesucht haben? Zu dieser Tageszeit kann Sie gewiss nur eines in das Viertel Alt-Anarkali geführt haben, das, wie Sie bestimmt wissen, nach einer Kurtisane benannt ist, die wegen ihrer Liebe zu einem Prinzen eingemauert wurde – und das ist die Suche nach der perfekten Tasse Tee. Habe ich richtig geraten? Dann gestatten Sie mir, Sir, Ihnen mein Lieblingslokal unter den vielen hier zu empfehlen. Ja, genau, dieses hier. Die Metallstühle sind nicht besser gepolstert, die Holztische sind genauso roh, und wie die anderen ist es auch unter freiem Himmel. Doch ich versichere Ihnen, die Qualität des Tees ist ohnegleichen.
Sie sitzen lieber da, mit dem Rücken so dicht an der Wand? Wie Sie wollen, obwohl Sie dort weniger von der Brise haben, die immer mal wieder auffrischt und die die warmen Nachmittage angenehmer macht. Und wollen Sie nicht Ihr Jackett ablegen? So förmlich! Das ist ja nun nicht typisch amerikanisch, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Und meine Erfahrung ist beträchtlich; ich habe viereinhalb Jahre in Ihrem Land gelebt. Wo? Ich habe in New York gearbeitet, und davor war ich an einem College in New Jersey. Ja, Sie haben recht: Es war tatsächlich Princeton! Gut geraten, das muss ich sagen.
Wie ich Princeton fand? Nun, die Antwort auf diese Frage bedarf einer Geschichte. An meinem ersten Tag dort betrachtete ich die gotischen Gebäude um mich herum – die, wie ich später erfuhr, jünger als viele der Moscheen dieser Stadt sind, aber mittels einer Säurebehandlung und geschickter Steinmetzarbeit auf alt gemacht – und dachte, ein Traum ist wahr geworden. Princeton weckte in mir das Gefühl, mein Leben sei ein Film, in dem ich die Hauptrolle spielte und alles möglich war. Ich habe Zugang zu diesem schönen Campus, dachte ich, zu Professoren, die auf ihrem Gebiet Koryphäen sind, und Kommilitonen, die auf dem Weg sind, Philosophenkönige zu werden.
Ich muss zugeben, dass ich in meinen anfänglichen Mutmaßungen über das Niveau der Studentenschaft allzu großzügig war. Nahezu alle waren intelligent und viele auch brillant, aber während ich in meinem Eingangsseminar einer von nur zwei Pakistanis war – zwei von einer Bevölkerung von über hundert Millionen Seelen, müssen Sie wissen –, hatten es die Amerikaner in dem Auswahl-prozess mit einer weit weniger entmutigenden Relation zu tun. Eintausend Ihrer Landsleute wurden immatrikuliert, fünfhundert Mal so viele also, obwohl die Bevölkerung Ihres Landes nur doppelt so groß wie die meines ist. Die Folge war, dass die Nicht-Amerikaner unter uns im Durchschnitt bessere Leistungen zeigten als die Amerikaner, und ich selbst hatte mein Abschlussjahr erreicht, ohne auch nur einmal schlechter als »sehr gut« abgeschnitten zu haben.
Rückblickend wird mir die Macht dieses Systems klar; es ist pragmatisch und effektiv wie so vieles in Amerika. Wir internationalen Studenten kamen aus der ganzen Welt. Wir wurden nicht nur mit ausgefeilten Einheitstests ausgesiebt, sondern auch mit genau auf den Einzelnen abgestimmten Bewertungen – Auswahlgesprächen, Essays, Empfehlungen –, bis die Besten und Klügsten von uns identifiziert waren. Ich hatte exzellente Examensergebnisse in Pakistan und spielte außerdem noch so gut Fußball, dass ich in der Uni-Mannschaft mithalten konnte, wo ich auch einen Stammplatz hatte, bis ich mir im zweiten Jahr das Knie verletzte. Studenten wie ich erhielten Visa, Stipendien, also volle finanzielle Unterstützung, und wir wurden in die Welt der herrschenden Elite eingeführt. Als Gegenleistung erwartete man von uns, dass wir unsere Begabungen in Ihre Gesellschaft einbrachten, die Gesellschaft, der wir uns anschlossen. Und ganz überwiegend taten wir das auch gern. Ich jedenfalls, zumindest am Anfang.
In jedem Herbst ließ sich Princeton von den Personalleuten der großen Firmen, die auf den Campus kamen, in den Ausschnitt gucken und zeigte ihnen ein wenig Haut, wie Sie in Amerika sagen. Die Haut, die Princeton zeigte, war natürlich eine gute – jung, eloquent und klug wie nur etwas –, doch selbst inmitten all dieser Haut war ich, wie ich in meinem letzten Jahr wusste, etwas Besonderes. Ich war die perfekte Brust, wenn Sie so wollen – gebräunt, knackig und scheinbar der Schwerkraft trotzend –, und ich war überzeugt, jeden Job zu bekommen, den ich haben wollte.
Bis auf einen: Underwood Samson & Company. Sie haben nicht davon gehört? Es war eine Unternehmensberatung. Sie sagten ihren Klienten, wie viel eine Firma wert war, und das taten sie, wie es hieß, mit einer geradezu unheimlichen Präzision. Sie waren klein – eigentlich eine Boutique, minimale Belegschaft –, und sie zahlten gut; frisch vom College bekam man da ein Grundgehalt von über achtzigtausend Dollar. Was aber wichtiger war, sie gaben einem ein solides Handwerkszeug und einen gediegenen Markennamen, der war so gediegen, dass man nach zwei Jahren als Berater dort die Aufnahme zur Harvard Business School praktisch in der Tasche hatte. Deswegen schickten über hundert Angehörige des Princeton-Jahrgangs 2001 ihre Zeugnisse und Lebensläufe bei Underwood Samson ein. Acht wurden ausgewählt – nicht für einen Job, um das klarzustellen, sondern für ein Bewerbungsgespräch –, und einer davon war ich.
Читать дальше