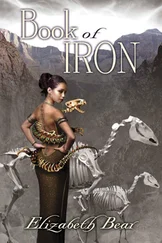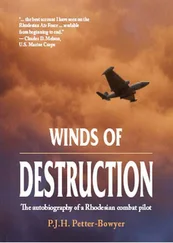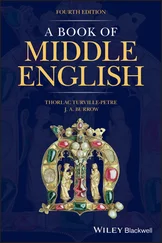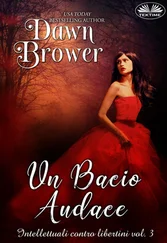Nach einem Jahrzehnt klagen viele der inzwischen ausgebildeten Therapeuten über die Unverbindlichkeit und geringe Stringenz ihrer Ausbildung, in der niemand gefördert werde und sich alle überfordert fühlen. Sie gründen ein konkurrierendes Institut, das mit geschlossenen Gruppen arbeitet, in denen alle Teilnehmer nach genauen Regeln anwesend sein müssen. Mehr als zehn Prozent Fehlzeiten sind nicht erlaubt, dann muss das Jahr wiederholt werden.
Nach einigen Jahren machen sich hier kritische Stimmen bemerkbar: Dieser Betrieb sei grässlich verschult, entmündige die Teilnehmer, es sei nicht einzusehen, weshalb erwachsene Menschen, die bereits ein Studium hinter sich haben, wie Schulkinder behandelt würden.
Erzwungene oder gewählte Ziele
Hierarchische Traditionen stecken in jeder entwickelten Kultur. Wenn es darum geht, schnell zu entscheiden, wo Rücksicht gefährlich – da zeitraubend – ist, wie im Krieg oder im Einsatz von Polizei und Feuerwehr, hat nach wie vor der schlichte Gehorsam seinen Platz. Aber ebenso wie der Feuerwehrkommandant seine Arbeit schlecht macht, wenn er angesichts eines brennenden Hauses zeitraubende Debatten zulässt, macht er seine Arbeit auch schlecht, wenn er in der Nachbesprechung der Einsätze solche Debatten verbietet, weil er sich angegriffen fühlt.
Die Verführung der Hierarchie zielt auf die menschliche Grandiosität, den Narzissmus, den unfehlbaren Tyrannen, der in jedem von uns steckt, oft am meisten in denen, die ihn hinter klingenden Worten vom „gemeinsamen Auftrag“ und der „Sache der Nation“ verbergen. Wenn Menschen Macht angeboten wird, sind sie verführt, diese zu missbrauchen. Jede hierarchische Position enthält dieses Angebot.
Kaum weniger tyrannisch sind daneben jene, die jede Machtausübung, jede Form von Autorität entwerten: Sie seien über derlei erhaben, und dürften daher auf alle herabblicken, welche nicht so frei von Machtgier sind wie sie selbst.
Die Geburt der Hierarchie aus dem Krieg und der Religion macht verständlich, dass es die viel später auftretende Sachautorität bis heute immer wieder schwer hat, sich durchzusetzen. In der Entwicklung der Industriegesellschaft ist das den Ingenieurswissenschaften und der Medizin gelungen. Kein Verwaltungsbeamter oder Theologe wird heute noch überzeugt sein, er könne angesichts der Konstruktion einer Brücke oder der Durchführung einer chirurgischen Operation seine Autorität ins Spiel zu bringen, um die Entscheidung eines ihm dienstlich untergeordneten Statikers oder Chirurgen infrage zu stellen.
Aber wenn wir uns die Diskussion in einem Jugendamt zwischen einem Verwaltungsjuristen und einer Sozialpädagogin über eine Frage der Familienhilfe vorstellen, sind wir nicht mehr so sicher, dass der Jurist nicht einmal daran denkt, die Expertenschaft seiner Mitarbeiterin infrage zu stellen. Noch ausgeprägter ist diese Problematik in der Krankenpflege, wo viele Ärzte nach wie vor überzeugt sind, dass sie auch in pflegerischen Fragen das letzte Wort haben müssen und die Vertreterinnen eines Expertentums in Pflegewissenschaft um ihre Anerkennung ringen.
Natürlich würden sowohl der Arzt wie der Jurist abstreiten, dass sie absolute Autorität beanspruchen; es gehe schließlich allein um die Sache. Aber wer die Definitionsmacht besitzt, der entscheidet auch, welchen Inhalt und welche Grenzen die „Sache“ hat. Damit behindert er alle, denen er eine vergleichbare Definitionsmacht abspricht, in der Entwicklung gemeinsamer Ziele.
Solche gemeinsamen Ziele sind aber eine wichtige Voraussetzung, dass moderne Institutionen funktionieren können: Nur so werden alle sachdienlichen Informationen gesammelt und gebündelt.
Die Verwirbelungen, die in jeder Hierarchie durch die kleinen, eigenen Hierarchien der Spezialisten auftreten, führen häufig zu dem Stoßseufzer, bestimmte Berufsgruppen (etwa Ärzte oder Psychologen) und Institutionen (etwa Forschungsinstitute oder Krankenhäuser) seien unregierbar. Das ist, wenn man dem Ideal der Befehlskette folgen möchte, auch richtig. In komplexen Systemen kann die Zielfindung nicht einfach von oben nach unten vorgenommen werden, weil dann unentbehrliche Informationen aus dem Netzwerk der regierten Experten verloren gehen.
Ein klassisches Modell, um gemeinsame Ziele zu definieren, ist die Spiegelung der großen Gruppe in einem kleineren Gremium, in dem dann diskutiert und entschieden werden kann. Dieses Modell gilt für die parlamentarische Demokratie ebenso wie den Kleingartenverein: Immer wird eine Gruppe gewählt, deren Zusammensetzung unterschiedliche Positionen der „Bevölkerung“ (des Landes, der Kleingartenanlage) spiegelt.
In Betrieben und Konzernen, in denen viele Fachleute zusammenarbeiten, werden eigene Gremien konzipiert und besetzt, welche die einzelnen Untergruppen bzw. Aufgabenbereiche spiegeln sollen: Finanzen, Marketing, Konstruktion, Personal.
Überall in solchen aus vielen formellen und informellen Gruppen aufgebauten Organisationen treten Rivalitäten auf und überschneiden sich Einflussbereiche. Während an der Spitze noch „alte“ Verhältnisse gespiegelt sind, hat sich die Basis erheblich verändert. Jene Gruppe, welche diese Veränderung trägt, kämpft irgendwann darum, auch an der Spitze stärker gespiegelt zu werden, da sonst an ihren Interessen vorbei entschieden wird.
Ein Beispiel sind die Laientheologen in der katholischen Kirche. In einem Bistum werden jährlich noch zwei Priester geweiht, gleichzeitig aber zehn Laientheologinnen und Laientheologen eingestellt. Diese sind akademisch ebenso qualifiziert wie Priester, können sich aber nicht zum Zölibat entscheiden. Sie werden in der Gemeindearbeit, in der Jugendarbeit, im Bildungsbereich und in der Klinikseelsorge eingesetzt.
Im Führungsgremium des Bistums, dem Domkapitel, dem der Bischof vorsteht, werden die Laientheologen dem Generalvikar zugeordnet, dessen Funktion der des Personalchefs in einem Betrieb entspricht. Die geweihten Priester sind daneben noch durch mehrere Domkapitulare vertreten, die für Seelsorge und liturgische Fragen zuständig sind, während die Laientheologen, deren Zahl ständig wächst und die in den jüngeren Jahrgängen der theologischen Funktionsträger längst in Überzahl sind, sich sozusagen nur in einem Bruchteil (den sie relativ klein einschätzen) des Generalvikars im Domkapitel gespiegelt fühlen. Irgendwann hat ein Laientheologe ausgerechnet, wie viel Geld für die Fortbildung seiner Gruppe ausgegeben wird und welche Kosten die Fortbildung und Betreuung der geweihten Priester verursacht. Das Missverhältnis ist krass.
Dabei stellt sich auch heraus, dass für das bistumseigene Priesterseminar, das in den letzten fünf Jahren jährlich ein bis zwei Priester ausbildete, nach wie vor ein Regens und ein Subregens beschäftigt werden, zwei hochbezahlte Fachleute, deren Stellen eingerichtet wurden, als noch jedes Jahr die Weihe von zwanzig neuen Priestern anstand.
Solche Situationen wirken auf den ersten Blick absurd, verraten auf den zweiten aber viel über die Beharrungskraft von religiös geprägten Hierarchien, die – anders als wirtschaftlich orientierte – den Druck einer veränderten Realität länger neutralisieren können und zäh an dem Überkommenen festhalten. Wir müssen uns nur fragen, wie lange ein Automobilkonzern eine Unterabteilung finanzieren würde, in der mit demselben Personal wie vor zwanzig Jahren zehn Prozent der damaligen Produktivität geleistet werden.
Man kann einwenden, dass es in einer Kirche um anderes geht als um wirtschaftliche Rationalität. Das ist richtig, aber auch eine religiöse Einrichtung lässt sich danach beurteilen, wie professionell sie arbeitet, wie viel von ihren Zielen sie mit den eingesetzten Mitteln erreicht und wo diese Mittel sinnvoller eingesetzt werden könnten als bisher.
Читать дальше