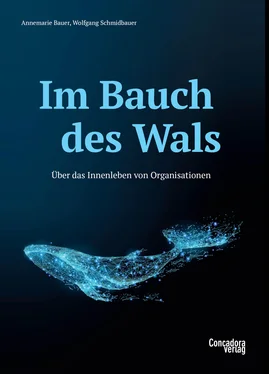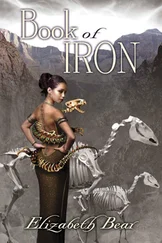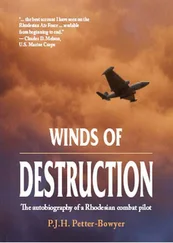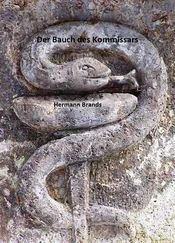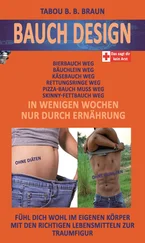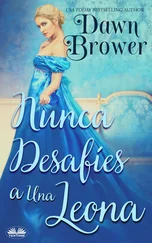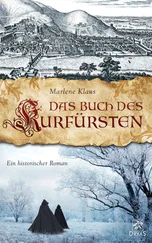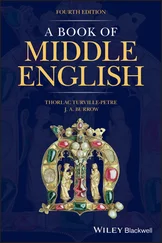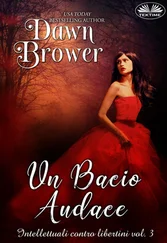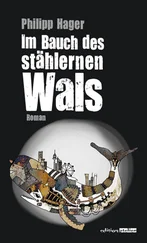Von der Industrie- zur Konsumgesellschaft
Mit zunehmender Entwicklung der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft wachsen die Progressionsforderungen immer weiter an, so sehr, dass heute viele Menschen den natürlichen Zyklus von Progression und Regression (Anspannung und Entspannung, Arbeit und Ruhe, Wachen und Schlafen) nicht mehr ohne medikamentöse oder psychotherapeutische Hilfe bewältigen können.
Arbeitsmöglichkeiten wie das klassische Handwerk, die durch ihre Struktur ein ausgewogenes Verhältnis von Progression und Regression erleichtern, sind selten geworden. Die Handwerksberufe haben durch einen hohen Grad der Maschinenhilfe ihr Gesicht völlig verändert. Die Arbeitsplätze in der Industrie gleichen sich in der Forderung nach konzentrierter Steuerung eines technischen Geschehens mehr und mehr. Ein Erdarbeiter, der einen Bagger lenkt, ein Schlosser, der einen Industrieroboter programmiert, ein LKW-Fahrer, ein Sachbearbeiter am Bildschirm – für sie alle ist ein ausgewogenes Verhältnis körperlicher und geistiger Anstrengung ebenso erschwert wie ein rhythmischer Wechsel von Anspannung und Erholung, von Progression und Regression.
Zugleich wachsen die Verantwortungen: Der Baggerführer sollte während der Arbeit stocknüchtern und hochkonzentriert sein; sein Vorgänger aus vorindustrieller Zeit, der Arbeiter mit Hacke und Schaufel, musste sich nicht derart kasteien. Wer mit einer Motorsäge oder Motorsense arbeitet, findet den Unterschied zur Arbeit mit Handsäge und Handsense schnell heraus. Die Maschine verändert den Arbeitsrhythmus. Sie zwingt, sich auf ihre Erfordernisse einzustellen und ihre Abgase einzuatmen. Die Ausdauer steigt; die körperliche Ermüdung setzt später ein als die nervöse Erschöpfung.
In der Industriegesellschaft wurde die Arbeitswoche von vielen regressiven Elementen gereinigt. Die Pausen wurden kürzer, die innerbetrieblichen Kontaktmöglichkeiten vermindert, wie es die Maschinen und das Fließband geboten. Der letzte und vielleicht einschneidendste Einsamkeitsschub gehört bereits in die Konsumgesellschaft: der Bildschirm. Zu dieser Entwicklung gesellte sich ein regressiv geprägter Anspruch: sich am Wochenende konzentriert zu erholen.
Der Kopfarbeiter sucht nachts – nervös erschöpft, aber körperlich nicht müde – angestrengt nach Schlaf, weil er sich sonst nicht genügend für die Anforderungen des morgigen Tages ausruht. Eine ähnliche Blockade realistischer Regressionsmöglichkeiten durch Überforderung signalisiert der charakteristische Wochenend-Streit zwischen Eheleuten. Die während der Arbeitstage gemäßigten Ansprüche an die befriedigenden Qualitäten der Beziehung steigern sich zu explosiven Enttäuschungen („wenn ich schon die ganze Woche arbeite, dann will ich am Wochenende wenigstens etwas von dir / der Familie / den Kindern haben“).
Die Identität in der Industriegesellschaft wird durch die Qualität des Menschen als Berufsarbeiter erworben. Während in den traditionalen Gesellschaften die Geschlechter eine polare Identität hatten (Bauer – Bäuerin, Meister – Meisterin), verlieren in der bürgerlichen Familie viele Frauen diese Funktion und gewinnen erst durch die Emanzipationsbewegung ihren Anteil an den Individualisierungsprozessen der Moderne. Jedes Liebespaar muss seine eigene Beziehung aushandeln. Karrierefrau und Hausmann ist als Kombination ebenso möglich wie Karrieremann und Hausfrau, auch wenn wir noch weit von einer statistisch ausgewogenen Mischung dieser Modelle entfernt sind.
Diese Situation führt dazu, dass die Zyklen von Disziplin und Regression, die in den traditionellen Geschlechtsrollen stecken, zerrissen werden. Wenn klar ist, dass Männer nicht rechnen und Frauen nicht kochen können, ist in allen Ehen auch die Frage geklärt, wer kocht und wer die Steuererklärung macht. Damit sind auch die Konkurrenzmöglichkeiten und ihn ihnen die Gesamt-Konfliktlast verringert.
Moderne Eheprobleme hängen oft damit zusammen, dass nach einem anstrengenden Tag beide Geschlechter in einem gemütlichen Zuhause regredieren wollen. Nur: Wer macht es dort gemütlich? Wer bestätigt für die erbrachte Leistung, wer organisiert die verdiente Erholung? Wer darf mit den Kindern spielen, wer muss sie erziehen?
Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern kann durch kulturelle Rollenvorgaben betont werden, wie es in traditionellen Gesellschaften der Fall ist, die jedes Geschlecht gezielt in bestimmten Bereichen behindern, um die wechselseitige Abhängigkeit zu stabilisieren. Ivan Illich hat diesen Zustand idealisiert und der heutigen „Unisex“-Gesellschaft kritisch entgegengehalten, in der nicht mehr Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen konkurrieren, sondern auch Männer gegen Frauen und Frauen gegen Männer (Illich 1983).
Wenn es wahr ist, dass die Großmutter einer Traktorfahrerin niemals einen Zugochsen geschirrt und gelenkt hat, lässt sich auch nicht leugnen, dass sich eine Mehrzahl der Menschen gegen diese Rollenverteilungen entschieden hat. Dem Kulturkritiker (und auch dem Therapeuten) fallen vor allem die Personen auf, die an dieser Entwicklung scheitern. Er sieht, wie groß die Versuchungen sind, die Nachteile der Gleichheit abzuspalten und sich erst einmal auf ihre Vorteile zu freuen. Männer können auch gefühlvoll sein und sich fallen lassen, Frauen sich kämpferisch durchsetzen und berufliche Erfolgserlebnisse sammeln. Die traditionelle Welt wird von so vielen Menschen als eng und drückend erlebt, dass sie sich überall dort auflöst, wo ihre Bürger diese Wahl haben. Kulturpessimisten mögen darin ein apokalyptisches Risiko der Menschheit sehen, und vielleicht haben sie recht.
Die Spaltungsprobleme der Konsumgesellschaft
Das zentrale Problem der Konsumgesellschaft ist die Spaltung. Damit ist eine menschliche Neigung gemeint, die Nachteile und Widerwärtigkeiten einer Situation von ihren Vorzügen und Annehmlichkeiten zu trennen. In dem Spottmärchen Hans im Glück wird von einem jungen Mann erzählt, der einen Klumpen Gold, der den Nachteil hat, schwer zu sein, gegen ein Pferd tauscht, das den Nachteil hat, ihn abzuwerfen, worauf er das Pferd gegen ein weniger wertvolles Tier tauscht, das andere Nachteile aufweist, bis er schließlich wie erlöst nach Hause springt, weil er gar nichts mehr hat, das ihm lästig fallen könnte.
Solche Spaltungsvorgänge betreffen auch die Institutionen. So erlebt man in der Supervision oft Teams, die sich bitter beklagen, dass es so wenig Hierarchie und Struktur gebe, keiner kümmere sich um Absprachen und setze Verbindlichkeiten durch, es sei das reinste Chaos.
Wenn dann allerdings die Diskussion vertieft und genaue Pläne für Abhilfe entwickelt werden, lässt der Elan spürbar nach, weil jetzt plötzlich deutlich ist, dass die verbindliche Struktur und die Sanktionen, wenn Absprachen nicht eingehalten werden, einen auch selber treffen können, während in der bisherigen, von Spaltungsprozessen diktierten Rede die Unannehmlichkeiten der Disziplinmängel von Kollegen, nicht aber die Annehmlichkeiten gelegentlicher eigener Disziplinlosigkeiten berücksichtigt worden waren.
Die Konsumgesellschaft stimuliert solche Entwicklungen, weil es in ihr zum sozialen Leitbild wird, ohne Reue zu genießen und alle Produkte damit werben, dass sie keinerlei Nachteile oder Folgekosten haben. Reparaturanfälligkeit, Energieverschwendung, Preisverfall plagen uns in der Realität oft genug; in den virtuellen Welten der Werbung werden wir sie nicht finden.
Die Spaltungsvorgänge führen zu einem Schwanken zwischen hierarchischer Strukturierung und flächiger Auflösung von solchen Strukturen. So wird ein Ausbildungsinstitut für Therapeuten gezielt als Antithese zu einem verschulten Betrieb entworfen. Selbstverantwortung gilt viel, jeder Teilnehmer bestimmt selbst, wie er sich sein Wissen aneignet. Schließlich sind das alles reife, selbstverantwortliche Personen, die nicht gegängelt werden dürfen.
Читать дальше