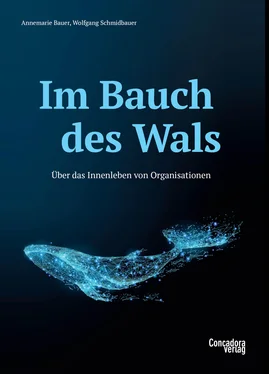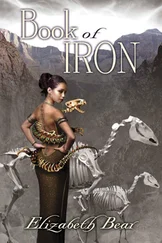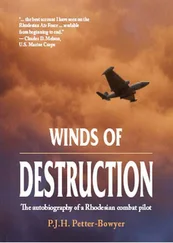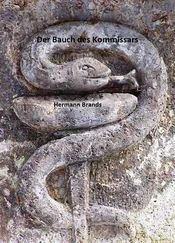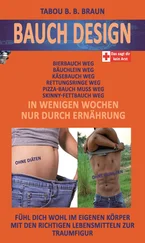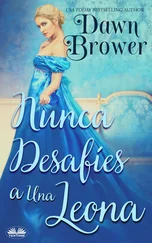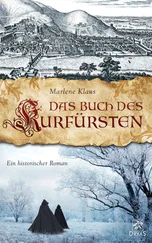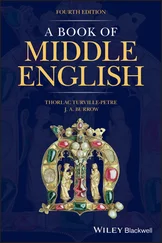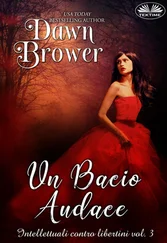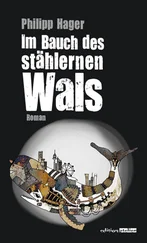Zur klassischen Hierarchie gehört die Identität von Dienst- und Fachaufsicht. Der Soldat beginnt als Rekrut; bewährt er sich, trägt er – wie es im absolutistischen Frankreich hieß – den Marschallstab im Tornister, kann er bis in das höchste Kommando aufsteigen. Also versteht er auch, einmal Marschall geworden, das Kriegshandwerk durch und durch, er weiß, was er befiehlt, er bewegt sich nur in einer Welt von Soldaten.
Aber in einer wissenschaftlich und technisch bestimmten Welt ist das nicht mehr möglich. In ihr gibt es Experten, und sie wären keine Experten, wenn sie nicht mehr wüssten als die Nicht-Experten. Wenn nun ein Nichtfachmann Dienstvorgesetzter eines Fachmanns ist, kann er nicht mehr unbeschränkt kommandieren. Er muss sich, wo das Fachwissen seine Einsicht übersteigt, dem Experten fügen, nicht umgekehrt, sonst wird die Organisation Schaden leiden.
Viel von der Unübersichtlichkeit, die oft und zurecht in der modernen Welt beklagt wird, rührt aus diesem Problem. Das weiß jeder, der einerseits – weil er zahlt – die Macht über einen Experten hat, andrerseits aber – weil er weniger weiß als dieser – dem Experten ausgeliefert ist. Hier wird auch verständlich, dass Teamwork, vernetztes Denken, offene Kommunikation keine Schlagworte sind, sondern notwendige Veränderungen, die mit dem Auseinandergehen von Macht und Wissen zu tun haben. Wo offen kommuniziert wird und verschiedene Fachleute ihr Wissen optimal einbringen können, werden die besten Entscheidungen getroffen, werden Fehler vermieden, wird Energie optimal genützt. Solange ein Vorgesetzter alle Macht und Geltung beansprucht, kann das nicht geschehen.
In unseren heutigen, rechtsstaatlich funktionierenden Einrichtungen gibt es keine absolute Macht mehr. Führungskräfte sind den Zielen der Organisation verpflichtet und den Gesetzen unterworfen. An sich sollte der einfache Mitarbeiter, der einen wichtigen Verbesserungsvorschlag entdeckt, ebensoviel Einfluss haben wie das Direktorium, weil die meiste Macht dem gehört, der die Ziele der Organisation am besten vertritt.
Autoritäre Strukturen veralten
In Fortbildungen für Führungskräfte wird heute betont, dass es die zentrale Leitungsaufgabe ist, Mitarbeiter zu motivieren, mit ihnen zu kommunizieren, ihre Anregungen zu beachten. Das ist nicht modisch, sondern logisch. Heute aber arbeiten die meisten größeren Organisationen auf einem so hohen Niveau der spezialisierten Arbeitsteilung, dass die Führung nur dann alle Kompetenzmöglichkeiten erschließt (und so die Wettbewerbsfähigkeit sichert), wenn sie die unterschiedlichen Spezialisten optimal einbindet.
Das bedeutet, dass an sich jeder Mitarbeiter, der eine gute Idee hat, auch den Anspruch äußern kann, dass sie umgesetzt wird. Wenn seine Vorgesetzten nicht mitspielen, kann er sich beschweren: sie wollen nicht tun, wofür sie (meist gut) bezahlt werden.
Moderne Professionalität fordert Führung; sie entzieht sich ihr nicht. Wer leitet, wird von einem professionell denkenden Mitarbeiter in Anspruch genommen. Er soll etwas für ihn tun, er soll ihn fördern, ihm zuhören, seine Verbesserungsvorschläge umsetzen helfen. Umgekehrt wird der Vorgesetzte respektiert und der Dialog mit ihm gesucht; es ist nicht so wie in der Sklaverei, wo die Arbeiter sogleich ihr Werkzeug fallen lassen, wenn ihnen der Boss den Rücken kehrt oder dem Aufseher die Peitschenschnur reißt.
In einer professionellen Zusammenarbeit wird die alte, absolute Autorität durch eine neue, die sogenannte Sachautorität ersetzt. Absolute Autorität ist diktatorisch; der Leiter weiß alles besser und muss nichts begründen. Sachautorität ist begründet; sie hat also einen Inhalt und eine Grenze.
Seit den Entwicklungen der Neuzeit bestimmen die Individuen nicht mehr durch Geburt, sondern durch Geschick und Leistung ihren Platz in der Gesellschaft. So ist die allseitige Rivalität als Prinzip möglich geworden. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Gegen diesen rufen die Staatstheoretiker der Neuzeit den Leviathan 3 auf den Plan, der diese Neigungen zur notfalls auch gewalttätigen Expansion des Einzelnen eingrenzen muss. So wird Führung zu einer doppelten Aufgabe: Wer sie beansprucht, muss einerseits sich selbst verwirklichen, anderseits seinen Platz im sozialen Organismus behaupten. Ohne die erste Qualität bleibt er ein Rädchen im Getriebe; ohne die zweite wird er bestenfalls ein Räuberhauptmann.
Ehrgeiz und Machtfantasie
Schrankenloser Ehrgeiz, Selbstüberschätzung und die Neigung, alle Mitmenschen, welche dem eigenen Ego nicht huldigen, für entweder töricht oder neidisch zu halten, sind keine späten Entgleisungen eines ursprünglich guten und bescheidenen Menschenkindes. Im Gegenteil, die Bescheidenheit, die Rücksichtnahme, das Verständnis für andere Positionen als die eigene sind spätere Zutaten, die auf komplizierten Anpassungs- und Einsichtsprozessen beruhen. Als tiefere Schicht bleibt unter ihnen die archaische Grandiosität erhalten. Sie kann, wenn sie unbewusst bleibt und nicht in einer bewussten Auseinandersetzung verarbeitet wird, jederzeit das vernünftige Ich übertölpeln.
Wenn ein Mensch sich mehr Macht und Einfluss wünscht, als das andere tun, dann kann dieses Motiv verschiedene Wurzeln haben. Eine erste ist die ursprüngliche narzisstische Grandiosität, die unter manchen Familienumständen besser erhalten bleibt als unter anderen. Ein Kind, das Verständnis für seine Machtfantasien erlebt, das in ihnen nicht tief gekränkt, sondern behutsam auf die realen Schranken gegen ihre Verwirklichung hingewiesen wird, kann sein Selbstbewusstsein besser aufrechterhalten als ein zur Bescheidenheit beschämtes oder geprügeltes. Ein von an sich liebevollen, jedoch ängstlichen Eltern zur Bescheidenheit gedrilltes Kind wird Mühe haben, sich später von den Fesseln zu befreien, die seiner Expansion und seinem Selbstbewusstsein angelegt wurden.
Manchmal ist die Grandiosität der kindlichen Allmachtsfantasie nicht durch Einfühlung der Eltern gemildert und schonend in ein realistisches Selbstbewusstsein übergeführt worden, sondern sie musste defensiv ausgebaut und übersteigert werden, um ein durch elterliche Ablehnung, übermäßige Kritik oder auch gesteigerte Bedürftigkeit der Eltern beschädigtes Selbstbewusstsein zu stabilisieren.
Die Entwicklung einer Person wird ebenso in der Pubertät und Adoleszenz geprägt wie in der Kindheit. Hier werden Haltungen erworben, in denen sich aus den früheren Erfahrungen, der Rezeption äußerer Einflüsse – etwa aus Büchern, Filmen, aus dem Umgang mit Schulkameraden, aus Begegnungen mit Freunden – etwas ganz Neues formt. Der Jugendliche kann sich beispielsweise entscheiden, „ganz anders“ zu werden als sein Vater. Er kann sich dabei einen Lehrer oder den Vater eines Klassenkameraden zum Vorbild nehmen.
Hier machen sich die ersten Rückkopplungsvorgänge bemerkbar, welche Störungen des Selbstgefühls so sehr festigen und verstärken können. Wer sein Bedürfnis, ganz anders (viel besser) als die realen Eltern zu werden, übersteigert, der wird auch unter den realen Menschen seiner adoleszenten Welt niemanden finden, der ihn begeistert. Das heißt, er muss sich mehr und mehr an imaginäre Vorbilder binden, die ihrerseits seine Realitätsorientierung und mit ihr seine Chancen schwächen, in einer Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit sein Selbstgefühl zu stabilisieren. Der so gestörte Jugendliche schwankt dann zwischen dem grandiosen Empfinden, besser zu sein als alle Menschen, die er kennt, und der depressiven Verzweiflung, dass alle anderen Lob und Freundschaft finden, während er selbst viel weniger Anerkennung erntet als die Dummköpfe und Langweiler um ihn.
Gesunder Narzissmus ist aufgabenorientiert und akzeptiert Durchschnittsleistungen als Basis für Spitzenleistung. Kranker Narzissmus ist erfolgsorientiert und lehnt durchschnittliche Leistungen ab. Typisch für eine solche Störung ist der Leiter, der seine Vorgänger und Wettbewerber entwerten muss, um die eigene Leistung in ein unrealistisch strahlendes Licht zu rücken.
Читать дальше