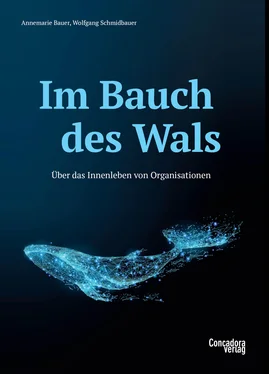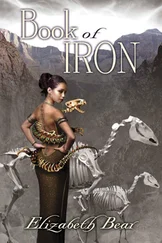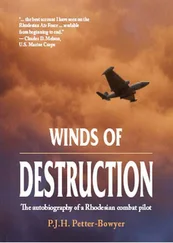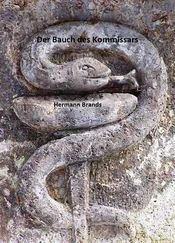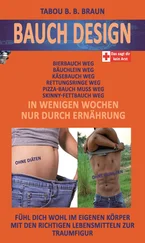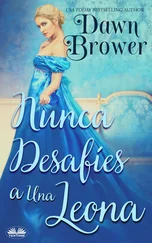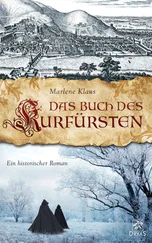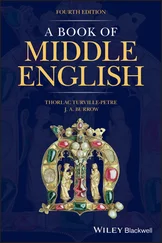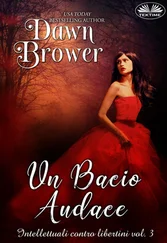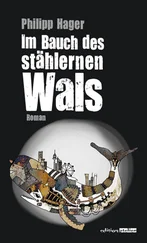Altsteinzeitliche Kulturen
Die altsteinzeitlichen Kulturen der Jäger und Sammler (wie die der oben erwähnten Buschmänner) haben manche „modernen“ Qualitäten: demokratische Herrschaftsprinzipien, Konfliktlösungen nicht mit Gewalt, sondern durch räumliche Trennung, Kindererziehung ohne Prügel (vgl. Lee & De Vore 1969, Schmidbauer 1973). Das liegt daran, dass die Paläolithiker es sich leisten konnten, kindliches und triebhaftes Verhalten lebenslang zu tolerieren. Es war überflüssig, Institutionen zu entwickeln, welche eine innere Disziplin und Leistungsorientierung aufbauen. Die Natur war hart genug gegen jeden Faulen und Nachlässigen.
Ein ausgewogenes Verhältnis zur Leistung und sozialen Ordnung war durch die Lebensumstände gegeben. Aufeinander abgestimmt, erzwangen die eigenen Bedürfnisse und die begrenzten Ressourcen einen zyklischen Wechsel von Ruhe und Anstrengung. In den traditionalistischen, agrarischen Gesellschaften, in denen es schon Vorräte an Nahrung gibt und das Saatgut aufgespart werden muss, dürfen die Menschen nicht so kindlich bleiben. Sie müssen eine innere Hemmung entwickeln, um nicht das zu tun, was auf der steinzeitlichen Kulturstufe selbstverständlich ist: zu essen, was da ist, und dann weiterzusehen. Ein Bauer würde dadurch sein Saatgut, ein Hirte seine Herde gefährden.
„Das Ohr des Schülers sitzt auf seinem Rücken. Er hört nur, wenn man ihn schlägt“, lautet ein altägyptischer Text. „Zerschlage seine Rippen, solange er noch klein ist“, heißt die verwandte Botschaft der Bibel (im Buch Jesus Sirach). Äußere Drohungen sind notwendig, um eine nicht mehr durch die eigenen Bedürfnisse, sondern durch agrarisch-feudale Zwänge motivierte Arbeitsleistung zu erbringen. Der Jäger und Sammler muss keine inneren Konsumbarrieren haben, weil er auch kein Saatgetreide hat, das er nicht aufessen darf. Deshalb ließen sich Jäger und Sammler auch so selten als Plantagenarbeiter verwenden. Sie starben unter den Arbeitszwängen oder ergriffen die Flucht in den Busch. An ihrer Stelle wurden die bereits agrarisch geprägten Afrikaner in die Neue Welt eingeführt (Lévi-Strauss 1958).
Die Institutionen der Jäger und Sammler sind einfach, flexibel und dynamisch. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen, aber viele Geschichten, die helfen, den Kindern die Umwelt zu erklären und die komplexen territorialen Verhältnisse zu ordnen, die eher auf ein harmonisches Ineinandergreifen unterschiedlicher Clans (Sippen) hinauslaufen als auf die Verteidigung eines abgegrenzten Gebiets. Es gibt keine großen sozialen Organisationen, einfach deshalb, weil große Gruppen nur kurze Zeit an Orten versammelt werden können, wo es viel Nahrung gibt, und wieder zerfallen müssen, sobald die Ressourcen dort erschöpft sind. Flexible, kleine Gruppen und eine flexible Verteilung der Aufgaben werden den Bedürfnissen dieser Kulturstufe am ehesten gerecht. Es gibt Männer, die Jagdzüge anführen, es gibt besonders angesehene, erfahrene, intelligente Frauen, aber es gibt keinen Häuptling, der mehr Macht hat, als sie ihm die flüchtige Zustimmung von Verwandten und Freunden zubilligt, welche jederzeit aus dieser Gruppe in eine andere Gruppe wechseln können, zu anderen Jagdführern.
Die Geburt der Hierarchie
In der sogenannten „neolithischen Revolution“ wurden die schweifenden Jäger und Sammlerinnen sesshaft. Dieser Prozess begann in den fruchtbaren Flusstälern Afrikas und Asiens – am Nil, am Euphrat und Tigris, am Indus, Ganges und Yangtsekiang. Er dauerte einige Jahrtausende und veränderte bis heute das Gesicht der Erde, ebenso wie die industrielle Revolution, in der die moderne Gesellschaft entstand. Beiden Veränderungen ist auch gemeinsam, dass sie die Kulturen an den Rand drängten, die nicht an ihnen teilhaben konnten.
Ackerbau und Viehzucht verändern die Gesellschaft stark. Während den Jägern und Sammlern Grundbesitz bedeutungslos ist, wird er dem Ackerbauern unendlich wichtig und eine Quelle von Streit, der wiederum nach Institutionen verlangt, ihn zu schlichten. Die wirtschaftlichen Rituale der Jäger und Sammlerinnen sind vor allem Rituale des Teilens – Schwangere und Kinder werden bevorzugt, Verwandte müssen bedacht werden, wer den Pfeil geliehen, die Spitze geschärft, die Beute zuerst gesehen hat, bekommt seinen Anteil.
Die ökonomischen Rituale der Ackerbauern betreffen vor allem die Abgrenzung und sehr bald die Hierarchie: Wer ein Stück Land besitzt und bebaut, ist frei und sein eigener Herr. Wer kein Land besitzt, ist unfrei und muss für einen Herrn arbeiten. Für den Hirten sind Herde und Weiderecht, was dem Ackerbauern das Feld ist. Damit geraten auch große gesellschaftliche Gruppen in aggressive Auseinandersetzungen, die zuvor nicht denkbar waren. Die älteste davon ist der Streit zwischen Kain und Abel, zwischen dem Ackerbauern und dem Hirten. Es ging hier ursprünglich nicht um das göttliche Wohlgefallen für den einen oder den anderen (die Bibel wurzelt in den Überlieferungen von Hirten-Nomaden), sondern um eine ökonomische Auseinandersetzung. Wenn eine Herde seine Felder kahl frisst, ist der Bauern vom Hunger bedroht und wird sich mit allen Mitteln wehren.
Die feste Zuordnung von Land spiegelte sich in der sozialen Organisation. Es musste eine feste, autoritäre Struktur geben, die die Besitzverhältnisse regelte und verteidigte. Kleine, weit verstreute Gruppen von Ackerbauern konnten noch, wie etwa die isländischen Siedler, mit einer relativ einfachen Struktur auskommen, in der es freie Bauern und leibeigene Knechte gab. Die Bauern regelten alle Streitigkeiten auf der gemeinsamen Versammlung, dem Thing; wer gegen das Thing verstieß, wurde geächtet, d. h. er wurde rechtlos und konnte von jedem getötet werden.
In dichter besiedelten Gebieten, vor allem in denen, wo künstliche Bewässerung eine genaue Verteilung nicht nur von Landsondern auch von Wasserrechten erforderte, mussten die Kulturen straffere Organisationen ausbilden. Es entstanden die ersten Königreiche, in denen schnell die Doppelgesichtigkeit der Macht deutlich wurde: Um Gerechtigkeit zu sichern und den Besitz der eigenen Gruppe nach außen zu verteidigen, mussten große, straff organisierte Gruppen von Kämpfern gebildet werden, die – anders als die Krieger der Jägerkulturen – unabhängig von Lust und Laune in die Schlacht zogen. 2
Solche Kriegerheere entwickeln eine Eigendynamik, sie wollen nicht nur verteidigen, sondern sie müssen auch erobern, um Land für die Versorgung der verdienten Kämpfer zu gewinnen. Das Sprichwort vom Angriff, der die beste Verteidigung sei, ist ein Erbe dieser Epoche, die auch Feudalzeit genannt wird, weil in ihr der Feudalherr, der Besitzer eines im Kampf erworbenen Rittergutes die bestimmende Gestalt war.
Die Institution der Hierarchie ist bis heute ein zentrales Element im Aufbau der Gesellschaft. Sie kann ihre militärischen Ursprünge nicht verleugnen. Da die Wehrhaftigkeit überlebenswichtig war, um nicht der Gier eines Nachbarn zu erliegen, wurden (und werden bis heute) in militärischen Hierarchien, die für die soziale Ordnung seit dem Neolithikum beispielgebend sind, auch krasse, oft rücksichtslose und brutale Mittel eingesetzt, um den Soldaten bei der Stange zu halten – einer Stange, die eine geschliffene Spitze trug und die wichtigste Waffe der frühen Kriegerkulturen war: die Lanze.
Die ersten Hierarchien spiegeln die Notwendigkeit, sich im Kampf zu organisieren. Die Möglichkeit, Überschüsse an Nahrung zu erzeugen und damit größere Menschengruppen längere Zeit beieinander zu halten, erzwang auch geordnete, große Gruppen, um diese Vorräte zu verteidigen. Jäger und Sammler können solche Kriege nicht führen; es gibt bei ihnen wenig zu erbeuten und macht dort wenig Sinn, Sklaven zu halten.
Die kulturelle Evolution spiegelt die biologische: Erfolgreiches setzt sich durch und verdrängt jene, die der Konkurrenz nicht standhalten können. Keine unorganisierte Gruppe von Jägern und Sammlern kann auf Dauer einer disziplinierten und hierarchisch aufgebauten Truppe widerstehen, die den Kampf wie ein Handwerk gelernt hat und einheitlich mit durchdachten und erprobten Menschentötungswerkzeugen ausgerüstet ist. Möglich ist allenfalls ein Guerillakrieg, der aber nur dann geführt werden kann, wenn der militärisch überlegene Feind bereit ist, die Frauen und Kinder der Guerillakämpfer zu schonen. Das haben die frühen Krieger der Feudalzeit meist nicht getan.
Читать дальше