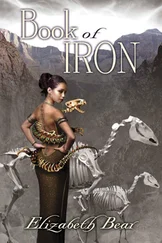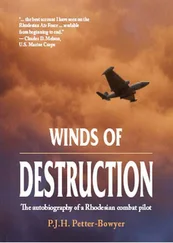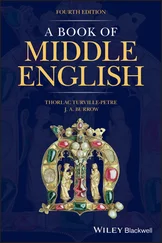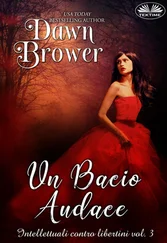Die sexuellen Triebe sind so mächtig, dass ihre Stärke jeden Menschen – Kinder wie Erwachsene, Männer wie Frauen – bedroht. Das von Natur und Kultur gleichermaßen vorgesehene Gegenmittel ist ein einfühlender Partner. Ihn braucht das Kind ebenso wie der Erwachsene, um seine Libido zu regulieren. Mit seiner Hilfe kann es gelingen, diese Energie zu bändigen; ohne ihn greift das Trauma um sich; es fasst nach dem „nur“ vereinsamten Kind ebenso wie nach dem missbrauchten, das einem Erwachsenen ausgeliefert ist, der sich – ebenfalls aus Mangel an von Empathie bestimmten sozialen Bezügen – an Geschöpfen vergreift, in die er seine eigenen Bedürfnisse projiziert.
Den vieldeutigen Untersuchungen über anatomische Unterschiede im Zentralnervensystem von Männern und Frauen lassen sich bisher nur in populären Magazinen verhaltensnahe Aussagen abgewinnen. Das gesunde Gehirn funktioniert ganzheitlich; Rückschlüsse von neurologischen Störungen auf das normale Verhalten sind daher gerade aus physiologischer Sicht bedenklich. Im Gehirn wurden stammesgeschichtlich ältere Komponenten durch die Entwicklung der Großhirnrinde überformt; diese Situation ist bei Männern und Frauen identisch. Daher gehört ein beträchtliches Maß an psychologischer Ignoranz dazu, von anatomischen Unterschieden im Althirn naiv auf genetisch angelegte Unterschiede im Verhalten zu schließen; das ist ungefähr so wissenschaftlich, wie zu behaupten, dass ein aus Stahl gefertigter Motor anders arbeitet als einer aus Aluminium. Natürlich ist Stahl etwas anderes als Aluminium, und der Metallurg kann dem Konstrukteur wertvolle Hinweise geben. Aber kein Metallurg wäre so dreist, zu behaupten, dass er durch seine Erkenntnisse über das Aluminium gänzlich neue Gesichtspunkte über Explosionsmotoren gewonnen hat.
Kein Zweifel kann hingegen daran bestehen, dass Männer und Frauen in ihren sexuellen Funktionen sehr unterschiedlich sind. Die bisher gültigste Konzeption der Geschlechtsunterschiede basiert auf der seelischen Verarbeitung dieser Situation.
Das männliche Kind beobachtet an der Schwelle zu seiner geistigen Verselbstständigung, dass es anders ist als die Mutter und dass es nie so werden wird wie sie. Es entdeckt, dass es die Mutter nicht kontrollieren und nicht befriedigen kann; wenn die Mutter unglücklich ist, braucht sie einen Mann, keinen Knaben; wenn sie die Illusion aufbaut, sie könne auch ohne Mann dem Knaben alles geben, was er braucht, verführt sie den Sohn zur Größenfantasie, die er später nur schwer wird ablegen können.
Der Naturmensch als Konzept einer fortgeschrittenen Kultur
Der Gedanke, dass es möglich sei, den Menschen der Kultur gegenüberzustellen, ist ein Kind der Aufklärung. Erst als die menschliche Vernunft sich sozusagen selbst entdeckte, gelang es ihr auch, von einer Tradition Abschied zu nehmen, in der ein „guter“ Mensch der ist, der den Normen der Kultur folgt. Zuvor gab es keine Möglichkeit, die Normen der Kultur infrage zu stellen; sie verstanden sich von selbst.
Die Entwicklung einer autonomen Vernunft hängt mit der Naturwissenschaft zusammen; eine ihrer Schlüsselsituationen ist der Prozess von Galilei: Darf ein Forscher behaupten, was der herrschenden Kultur widerspricht, weil er vernünftige Beweise dafür hat?
Nach anfänglichen Niederlagen hat die Wissenschaft hier den Sieg davongetragen – keineswegs endgültig, denn in vielen einst aufgeklärten Staaten sind inzwischen Fundamentalisten auf dem Vormarsch, die beispielsweise die Evolutionstheorie am liebsten verbieten oder so umformen wollen, dass nur ihre Feinde vom Affen abstammen, sie selbst jedoch von Gott geschaffen wurden.
Die wissenschaftliche Betrachtung erfasst nur eine Wechselwirkung von Kultur und Mensch. Sie stellt Fragen, die in eine ganz andere Richtung gehen als die der klassischen Religionen. Freud sucht in einigen seiner kulturtheoretischen Arbeiten nicht mehr nach einer Antwort auf die Frage, wie der gute Mensch beschaffen sei, sondern ob die Kulturforderungen selbst nicht dafür verantwortlich sind, dass so viele Menschen sich schlecht fühlen und unter Umständen auch schlecht handeln.
Die formende Kraft der Zweierbeziehung wird hier ganz neu gesehen: Ihr Auftrag ist es, dem Kind die ersten Ansätze der Kultur nahezubringen; im späteren Leben bildet sie den wichtigsten Kitt, um unterschiedliche Kulturen zu verbinden und aus ihnen etwas Neues zu schaffen. In der mobilen Gesellschaft gibt es viele Konfliktpotenziale, die daher rühren, dass Männer und Frauen mit ganz unterschiedlichem familiären Hintergrund versuchen, zusammenzukommen und zusammenzubleiben. Aber wo diese Konflikte überwunden werden, entsteht auch das spezifisch moderne, weltoffene, aufgeschlossene Bewusstsein, das Toleranz nicht nur predigt, solange es zu schwach ist, das eigene Glaubensmonopol durchzusetzen.
Die ältesten Institutionen
Eine fremde Kultur ist anders. Das steht schon in den ersten Berichten, die es überhaupt gibt, etwa in den Historien des Herodot, eines jonischen Griechen, der im vierten Jahrhundert vor Christus reiste. Er erzählt eine lehrreiche Geschichte, die man als Urszene des Kulturvergleichs ansehen kann.
Der persische Großkönig wollte herausfinden, ob es ein „richtiges“ menschliches Verhalten für den Umgang mit Verstorbenen gibt. Er ließ deshalb Vertreter zweier Völker seines Riesenreiches vor sich treten – die Griechen, welche ihre Toten verbrennen, und einen asiatischen Stamm, bei dem es Sitte war, die Verstorbenen zu essen.
Die Stammesangehörigen fanden es abscheulich, verehrungswürdige Tote zu verbrennen; die Griechen schauderten bei dem Gedanken, ihre Toten zu verspeisen. Das Ergebnis der Beratung war also, dass jedes Volk die eigenen Sitten für die besten hält, sie idealisiert, während es sich über fremde Sitten erhebt bzw. sie ablehnt.
Was Herodot „Sitten“ nennt, hat viele Namen: Bräuche, Rituale, Benimmregeln, soziale Normen. Der präziseste Begriff dafür ist Institutionen. Abgeleitet von dem lateinischen Wort für einrichten, erfasst dieser Begriff alle Gebilde, die zwischen dem biologischen Organismus und seiner sozialen Umwelt seit alters her vorhanden oder eben im Entstehen begriffen sind. Solche Institutionen sind ebenso universell wie oft schwer wahrnehmbar, weil wir nur ausnahmsweise nicht in ihnen handeln, sondern über sie nachdenken.
Institutionen begleiten uns von der Geburt bis nach unserem Tod, denn sie legen fest, wie wir begraben werden, welcher Stein mit welcher Inschrift auf unserem Grab steht und wie der Toten gedacht wird. Sie unterscheiden zwischen arm und reich, zwischen sozial angesehen und sozial geächtet – und sie verändern sich, langsam in traditionellen Gesellschaften, rasch in der Moderne.
Einige der wichtigsten Institutionen sind die unterschiedlichen Rollen, welche den Geschlechtern und den Altersklassen zugeschrieben werden. Rolle war ursprünglich der auf gerolltem Papier geschriebene Text, den ein Schauspieler vor seinem Auftritt wissen musste. In der Soziologie dient dieser Begriff dazu, soziales Verhalten ähnlich den Vorschriften zu erfassen, die der Theaterdichter für seine Spieler geschaffen hat.
In den ältesten Kulturen, die wir kennen, sind die Rollen flüchtig und stark biologisch orientiert: Männer und Frauen, Kinder und Alte verhalten sich in unterschiedlichen Rollen. Aber es gibt z. B. keine festen Berufsrollen und keine strikt rollenspezifische Arbeitsteilung. Bei den Buschmännern, einem Jägervolk der Kalahari, sind z. B. alle Männer und Frauen auch potenziell Schamanen, sie können sich oder andere in einem Tranceritual von Krankheiten heilen. Zwar ist das Sammeln eher Frauen-, das Jagen eher Männerarbeit, aber diese Rollenteilung ist längst nicht so strikt wie die ausgefeilten Arbeitsteilungen mancher agrarischen Kulturen, in denen es für Männer verboten ist, „weibliche“ Werkzeuge auch nur zu berühren (oft mit dem Argument, sie würden dann impotent werden). Wenn Frauen auf ihren Streifzügen ein Beutetier treffen, das sie erlegen können, tun sie das; wenn Männer keine Beute finden, sammeln sie Früchte, Wurzeln oder wilden Honig.
Читать дальше