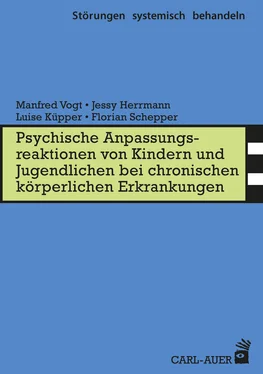Allergische Konjunktivitis und Rhinitis werden meist durch Inhalationsallergene wie Pollen, Tierhaare, Haustaubmilben und Schimmel ausgelöst. Zu den Symptomen der Konjunktivitis gehören Juckreiz, tränende Augen, Fremdkörpergefühl und Lichtscheue. Rhinitis ist gekennzeichnet durch Niesattacken, klare Sekretion, Juckreiz, Brennen und eine behinderte Nasenatmung. Die Diagnostik erfolgt meist über eine Familienanamnese, eine Testung möglicher Allergene sowie, bei Rhinitis, eine Rhinoskopie. In beiden Fällen helfen Augen- bzw. Nasentropfen, bei schwerer Symptomatik auch kortisonhaltige Präparate (Niessen u. Bachert 2001).
10 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden an Asthma bronchiale – gekennzeichnet durch eine Obstruktion der Bronchien sowie eine bronchiale Schleimhaut, die hypersensibel auf Umwelteinflüsse reagiert. Bei einem Asthmaanfall kommt es zu akuter Luftnot, die von Schweißausbrüchen, Angst und Panik begleitet sein kann. Es können charakteristische Atemgeräusche wie Giemen und Pfeifen auftreten (Niessen u. Bachert 2001). Während eines Asthmaanfalls kommen Inhalationssprays auf der Basis von Betasympathomimetika oder Kortikosteroiden zum Einsatz. Teilweise müssen Patienten nach einem Anfall stationär aufgenommen und vorübergehend beatmet werden.
Die Therapie von Asthma ist multimodal und zeitaufwendig, wobei auf Symptomfreiheit oder zumindest eine verminderte Anfallsfrequenz abgezielt wird. Dafür müssen identifizierte Allergene gemieden und eine prophylaktische antiallergische Therapie bzw. eine Desensibilisierung durchgeführt werden. Langfristig soll die Entzündung der Atemwege unterbunden, die bronchiale Hyperreaktivität reduziert und die Lungenfunktion wiederhergestellt werden. Kortikosteroide sollen den entzündlichen Prozessen entgegenwirken. Bei Auslösesituationen, die auf erhöhten psychischen Stress zurückzuführen sind, hilft Psychotherapie, um das Stressmanagement zu optimieren (Niessen u. Bachert 2001). Spezielle Schulungsprogramme für Patienten und ihre Angehörigen kombinieren die medikamentöse Versorgung mit Physio- und Sporttherapie, Klimatherapie, Psychoedukation, dem Erlernen spezieller Inhalationstechniken, Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung etc. (Bauer u. Petermann 2011). Generell ist eine Prognose schwer möglich. Zwar wird etwa die Hälfte aller Kinder im Vorschulalter mit gelegentlichem Pfeifen oder Giemen auffällig (Riedler 2015), doch verbessern sich die Symptome bei einem Großteil im Verlauf der Adoleszenz oder stellen sich ganz ein (Martin et al. 1980).
Neurodermitis tritt bei 16 % aller einjährigen Kleinkinder auf und ist damit eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Kindesalters. Im Verlauf der Kindheit und Jugend kommt es bei vielen Patienten zu einer Linderung der Beschwerden bis hin zur Remission, sodass die Prävalenz mit steigendem Alter sinkt (Niessen u. Bachert 2001). Von den Untersiebenjährigen sind etwa 13 % betroffen (Muntau 2007). Bei der Dermatitis äußern sich die Atopien in Entzündungen der Haut und in Ekzemen. Begünstigt wird dies durch eine häufig sehr trockene Haut, deren Barrierefunktion beeinträchtigt ist, durch eine Dysregulation der Immunantwort auf bestimmte Reize, durch eine vermehrte Ausschüttung von Juckreiz auslösenden Mediatoren sowie durch eine übermäßige Reizbarkeit der Haut durch externe Auslöser. Bei Säuglingen finden sich häufig atopische Ekzeme im Bereich der Gelenkbeugen, des Gesichts und des Kopfes. Die Symptomatik kann sich mit steigendem Alter stark verändern: Insbesondere im Schul- und Jugendalter sind v. a. die Beugen befallen und stark zerkratzt. Die Haut wirkt oft verkrustet, gerötet und verdickt. Betroffene schildern einen starken Juckreiz.
Sekundäre Komplikationen wie Infektionen durch die gestörte Haut-Umwelt-Barriere sind möglich. Auch leiden die Betroffenen häufig unter den kosmetischen Auswirkungen ihrer Erkrankung. Nicht nur ist die Haut sichtbar gerötet, schuppend trocken und zerkratzt, bei Befall der Kopfhaut kann auch Haarausfall auftreten. Überdies haben Betroffene ein erhöhtes Risiko, nach Ausheilen der Dermatitis an einer anderen Erkrankung des atopischen Formenkreises zu erkranken. Eine kurative Therapie für atopische Dermatitis ist nicht verfügbar. Im Fokus der Behandlung stehen u. a. die Identifikation und Vermeidung auslösender Allergene. Hierbei können diätetische Maßnahmen relevant sein. Weiterhin muss die Haut je nach Stadium der Erkrankung gut gepflegt werden. Bei manchen Entzündungen können Steroide zum Einsatz kommen. Begleitend stehen den Patienten und ihren Familien psychoedukative Einheiten, Hilfe beim Umgang mit dem Juckreiz sowie Rehabilitationsmaßnahmen zur Verfügung (Muntau 2007).
Von atopischen Erkrankungen betroffene Kinder leiden an durch Krankheitssymptome verursachte Unterbrechungen des nächtlichen Schlafs (Bender, Annett a. Strunk 2004; Chang a. Chiang 2016), was zu Unkonzentriertheit während des Tages führen kann. Überdies stellt Asthma einen Prädiktor für die Entwicklung einer Aufmerksamkeitsdefizit-Störung dar, welche die schulische Performanz zusätzlich negativ beeinflussen kann (Mogensenet al. 2011).
1.5.4Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Klinisches Krankheitsbild
Die beiden am häufigsten vorkommenden chronisch oder auch in Schüben verlaufenden entzündlichen Darmerkrankungen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
In der Pädiatrie betrifft in Mittel- und Nordeuropa Morbus Crohn fünf bis zehn von 100.000 Kindern und Jugendlichen jedes Jahr, die Inzidenz ist insgesamt zunehmend (Sitzmann u. Bartmann 2007). Die Erkrankung kann den gesamten Magen-Darm-Trakt betreffen, am häufigsten ist sie jedoch im distalen Dünndarm bis proximalen Dickdarm angesiedelt. Die Auslöser sind noch unklar, es wird von einem Zusammenspiel einer genetischen Komponente, Umweltfaktoren und Überreaktionen auf vorangegangene Infektionen ausgegangen. Die Symptome umfassen Bauchschmerzen, Fieber, Durchfall, Blutarmut und Gewichtsverlust, bei über 40 % treten vor Diagnose der Erkrankung bereits Veränderungen außerhalb des Magen-Darm-Trakts auf wie Gelenk- und Netzhautentzündungen.
Colitis ulcerosa wiederum kommt im Kindes- und Jugendalter etwas seltener vor und betrifft meist den unteren Darmtrakt. Häufig erfolgt die Diagnosestellung schneller als beim Morbus Crohn, da Colitis ulcerosa oft mit blutigen Durchfällen einhergeht (Karges u. Wagner 2010).
Beide Erkrankungen können nur durch eine Kombination verschiedener diagnostischer Maßnahmen nachgewiesen werden. Zu diesen zählen ein Blutbild, eine Sonografie, Endoskopie oder gar ein MRT, um Verdickungen und entzündliche Prozesse in nicht einsehbaren Bereichen des Magen-Darm-Trakts nachzuweisen. Auch eine Biopsie kann gemacht werden, in dieser sind die beiden Erkrankungen oft nur schwer zu unterscheiden (Niessen u. Bachert 2001). Ziel der Behandlung ist es, eine schnelle Remission zu erwirken, Rezidive zu vermeiden und dabei eine gute somatische und psychische Entwicklung zu ermöglichen. Dazu kommen immunsuppressive Medikamente und Glukokortikoide in akuten Schüben zum Einsatz, bei Bedarf werden Symptome von Mangelernährung ausgeglichen (Karges u. Wagner 2010). Operative Eingriffe werden vor allem bei Komplikationen wie Fisteln (nicht natürliche Verbindung zwischen zwei Hohlorganen) und Stenosen (Verengungen) vorgenommen. Im Falle von Colitis ulcerosa kann durch die chirurgische Entfernung des betroffenen Darmabschnitts sogar eine dauerhafte Heilung der Erkrankung erzielt werden (Sitzmann u. Bachmann 2007).
Betroffene chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen leiden häufig darunter, dass ihre krankheitsbedingten Symptome wie Durchfall und Blähungen oft peinlich und sozial einschränkend sind. Die Schwere der Erkrankungen korreliert negativ mit allen Dimensionen der subjektiven Lebensqualität: Je ausgeprägter die Erkrankung, desto schlechter beschreiben Patienten ihr allgemeines Wohlbefinden, Emotionalität, soziale Kompetenz und ihr Körperbild (Herzer et al. 2011).
Читать дальше