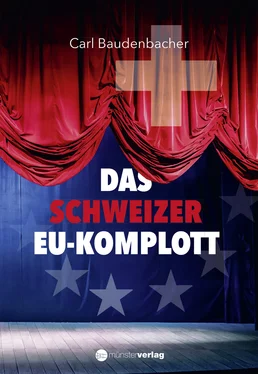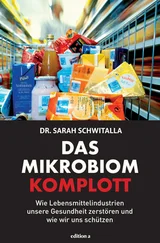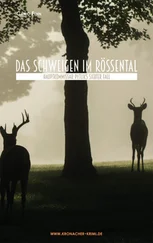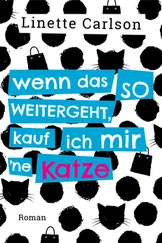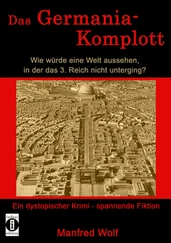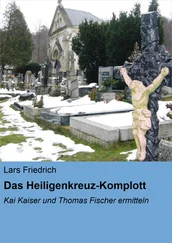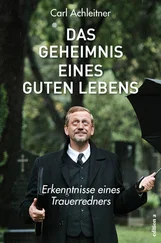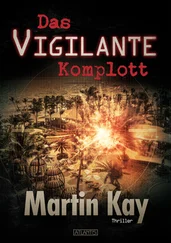Dennoch sah sich der Bundesrat veranlasst, einen Neutralitätsvorbehalt zu machen. In der Zwischenzeit ist deutlich geworden, dass weder das Vetorecht noch der Neutralitätsvorbehalt von grossem Nutzen sind. Vor allem im Steuerrecht hat sich gezeigt, dass ein Land sein Vetorecht nicht ohne Nachteile ausüben kann.
II.Zaungast bei der Gründung der EWG 1957
Das Inkrafttreten des von Frankreich, Deutschland, Italien und den drei Benelux-Staaten Belgien, Niederlande und Luxemburg am 24. Juli 1952 abgeschlossenen Vertrages zur Gründung der EGKS, der am 23. Juli 1952 in Kraft trat, bereitete der Schweizer Wirtschaft keine grossen Probleme. Das änderte sich mit der Gründung der EWG, welche eine Zollunion errichtete und gemeinsame supranationale Institutionen, insbesondere den Rat, die Kommission und den EuGH ins Leben rief. Die Schweiz befürchtete, dass ihre Industrie bei den Warenzöllen diskriminiert werden könnte. Ab 1956 versuchte die Schweiz daher zusammen mit Grossbritannien eine Teilung Westeuropas zu verhindern, indem sie für die Idee der Schaffung einer grossen Freihandelszoneinnerhalb der OEEC warb. Die Verhandlungen scheiterten jedoch am französischen Widerstand. Am 25. März 1957 schlossen die sechs Mitgliedstaaten der EGKS die Römischen Verträge, den Vertrag zur Gründung der EWG und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft EURATOM. Gleichzeitig wurde ein Abkommen geschlossen, nach dem EWG, EURATOM und EGKS eine gemeinsame parlamentarische Versammlung, einen gemeinsamen Gerichtshof sowie einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialausschuss haben sollten. Mit dem sog. Fusionsvertrag von 1965 wurden auch die bisher separaten Kommissionen und Ministerräte zusammengelegt. Der EWGV und der EURATOM-Vertrag traten am 1. Januar 1958 in Kraft. Die Schweiz tröstete sich damit, dass sie am 22. November 1958 in das GATT aufgenommen wurde.
III.EWG-Assoziationsversuch 1961–1963
Im Frühsommer 1961 wurde klar, dass das Vereinigte Königreich einen EWG-Beitritt anstrebte. Die beiden NATO-Länder Dänemark und Norwegen wollten nachziehen. Die drei Staaten waren zur Überzeugung gekommen, dass die «Zollmauer», welche das Gebiet der EWG umschloss, ihre Exporte behinderte und dass die entsprechenden Verluste nicht durch den Handel innerhalb der EFTA wettgemacht werden konnten. Die drei EFTA-Neutralen Österreich, Schweden und die Schweiz schlossen sich dem nicht an. Schweden und die Schweiz waren die Krösusse der EFTA, deren Wirtschaft nicht im gleichen Masse exportabhängig war wie die der drei Beitrittswilligen. In Österreich gab es nach wie vor Stimmen, die sich für einen Beitritt zur EWG aussprachen, aber die im Staatsvertrag von 1955 eingegangene Verpflichtung zur Neutralität machte einen solchen Schritt unmöglich. Zwischen 1961 und 1963 versuchten die drei neutralen Staaten, ein Assoziierungsabkommen mit der EWG auszuhandeln. Im Hinblick auf das, was dreissig Jahre später mit dem EWRA erreicht wurde, darf der Hinweis nicht fehlen, dass ein solches Abkommen auf einem Ein-Pfeiler-Modell beruht hätte. Es wäre von der Kommission überwacht worden und die gerichtliche Zuständigkeit hätte beim EuGH gelegen. Die assoziierten EFTA-Staaten wären in diesen Organen nicht verteten gewesen. Zwar hatte die Schweiz die Illusion, dass Konflikte durch ein Schiedsgerichtgelöst werden könnten. In einer Erklärung an den Ministerrat der EWG vom 24. September 1961 führte die Schweiz aus:
« Les divergences éventuelles touchant à l’exécution des obligations du traité d’association pourraient, en cas de besoin, être portées devant un organe arbitral statuant à la majorité, qui se prononcerait, selon les cas, soit sur le fond du problème soit sur d’éventuelles mesures de compensation .»
«Allfällige Divergenzen bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Assoziationsvertrag könnten erforderlichenfalls an eine mit Mehrheit entscheidende Schiedsstelle verwiesen werden, die je nach Fall entweder über den Inhalt des Problems oder über mögliche Ausgleichsmassnahmen entschiede.»
Die Verhandlungen erreichten aber nie ein Stadium, in dem die Frage besprochen wurde. Dass die EWG das akzeptiert hätte, kann aber ausgeschlossen werden. Da die britischen EWG-Beitrittsverhandlungen am Veto des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle scheiterten, verlief der Assoziationsversuch im Sande; zu direkten Verhandlungen mit Brüssel kam es nicht.
IV.Freihandelsabkommen mit der EWG 1972 10
Nach dem Rücktritt de Gaulles als Präsident Frankreichs am 28. April 1969 war die EWG bereit, das Vereinigte Königreich und andere Antragsteller aufzunehmen. Gleichzeitig bot die Gemeinschaft den Rest-EFTA-Staaten Verhandlungen über den Abschluss bilateraler Freihandelsabkommen ohne Rechtsharmonisierung und ohne Institutionen wie Überwachungsbehörde und Gerichtshof an. Die französische Regierung machte allerdings mit Autarkieforderungen Schwierigkeiten, die von den anderen fünf EWG-Staaten als grotesk bezeichnet wurden. Am 22. Juli 1972 unterzeichnete die Schweiz zwei Freihandelsabkommen, eines mit der EWG und eines mit der EGKS. Das Abkommen mit der EWG, das im Folgenden behandelt wird, zielte auf die Abschaffung von Zöllen und Kontingenten für gewerbliche Waren. Die übrigen Rest-EFTA-Staaten schlossen mit der EWG weitgehend inhaltsgleiche FHA’s. Obwohl es keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit gab, wurde das Freihandelsabkommen aufgrund seiner politischen und wirtschaftlichen Bedeutung dem obligatorischen Referendum unterstellt. Der Vertrag wurde von 72,5 % der Bevölkerung und allen Kantonenangenommen und trat am 1. Januar 1973 in Kraft.
10Auch oben, Kapitel 1, III.
Kapitel 3
EU-Begeisterung
I.Zeitenwende am Ende der 1980er Jahre
In den vom Kalten Krieg geprägten Jahrzehnten waren die Schweizer überzeugt, mit ihrer vorsichtigen Haltung der europäischen Integration gegenüber für die Zukunft bestens gerüstet zu sein. 1987 trat jedoch die Einheitliche Europäische Akte in Kraft, die erste umfassende Revision des EWGV, die auf die Vollendung des Binnenmarktes bis Ende 1992 abzielte. Die Schweiz beschloss daraufhin zusammen mit den anderen EFTA-Staaten, multilaterale Verhandlungen über den Abschluss eines umfassenden Assoziierungsabkommens mit der EWG, des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum EWR, aufzunehmen. Damit sollte eine Diskriminierung der Schweizer Industrie vermieden werden. 1989 endete der Kalte Krieg mit dem Zusammenbruch der Sowjetunionund der Befreiung der osteuropäischen Staaten. Die neutralen Staaten in Westeuropa begannen sich zu fragen, wozu ihr Status noch gut sei. In der Bundesverwaltung und im Bundesrat setzte sich die Auffassung durch, dass die Schweiz ihre übervorsichtige Europapolitik ändern sollte.
II.Schlechter Verlauf der EWR-Verhandlungen
Am 2. Mai 1992 unterzeichnete die Schweiz in Porto zusammen mit den anderen sechs damaligen EFTA-Staaten – Finnland, Island, Liechtenstein, Norwegen Österreich und Schweden – und der EU das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum EWRA und das Überwachungs- und Gerichtshofsübereinkommen («ÜGA»). Mit dem ÜGA wurden die EFTA-Überwachungsbehörde ( EFTA Surveillance Authority , «ESA») und der EFTA-Gerichtshof geschaffen. Das EWRA fusst auf einem Zwei-Pfeiler-Modell. Im EU-Pfeiler liegt die Überwachung in den Händen der Europäischen Kommission und die gerichtliche Kontrolle beim EuGH. Im EFTA-Pfeiler sind ESA und der EFTA-Gerichtshof zuständig. Die beiden EFTA-Institutionen sind strukturell unabhängig. Neues EWR-Recht entsteht durch Übernahme von EU-Recht. Dabei haben die EFTA-Staaten ein anspruchsvolles Mitspracherecht. Ziel des EWRA ist die Erstreckung des Binnenmarktes auf die EFTA-Staaten. Im Gegenzug öffnen diese ihre Märkte für Akteure aus den EU-Staaten.
Читать дальше