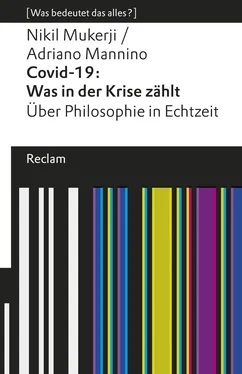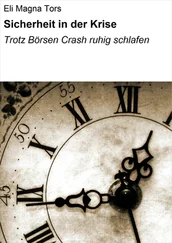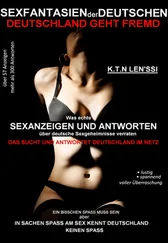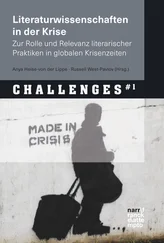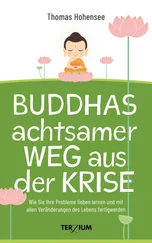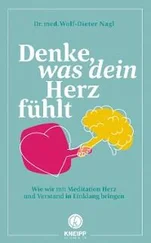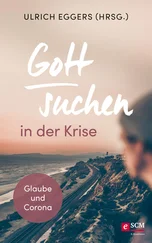4 Der Klimawandel: Nach Einschätzung der WHO kann der Klimawandel die Ausbreitung infektiöser Krankheiten aus mehreren Gründen begünstigen, etwa indem sich die klimatischen Bedingungen für die Ausbreitung bestimmter Krankheitserreger verbessern.
5 Flucht und Vertreibung: Millionen Menschen fliehen weltweit vor Armut, Verfolgung, Krieg und Naturkatastrophen und sind dabei besonders anfällig für Infektionskrankheiten wie Masern, Malaria, Diarrhö und akute Atemwegserkrankungen.
Halten wir also fest: Aufgrund der Vielzahl historischer Pandemien, der bekannten und weiterhin vorhandenen Übertragungswege von Tier zu Mensch und den für pandemische Krankheitserreger günstigen Bedingungen der modernen Welt war es nur eine Frage der Zeit, bis uns eine weitere Pandemie heimsuchen würde.
Bill Gates, der sich wie erwähnt seit langem mit der Prävention von Pandemien auseinandersetzt, führte bereits vor fünf Jahren aus: »Wenn irgendetwas in den nächsten Jahrzehnten mehr als 10 Millionen Menschen umbringt, dann ist es sehr wahrscheinlich ein hochinfektiöses Virus und kein Krieg.«
Natürlich wussten auch die nationalen und internationalen Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden um dieses Risiko. Die WHO und das RKI verfügen etwa über Pandemiepläne für Influenzawellen. Infolge der SARS-Pandemie des Jahres 2003 wurde nicht nur an Influenzapandemien gedacht. Der Ausbruch eines modifizierten, deutlich infektiöseren Coronavirus (Modi-SARS) wurde in einer Drucksache des Bundestages aus dem Jahr 2012 ausführlich besprochen.
Wenn These 1 zutrifft, war also durchaus vorhersehbar, dass die Welt früher oder später eine schwerwiegende virale Pandemie erleben würde. Dennoch haben die Entscheidungsträger nahezu aller westlichen Länder nicht mit hinreichender Alarmbereitschaft auf den Ausbruch von Covid-19 im chinesischen Wuhan reagiert. Noch am 11. März beklagte der Generaldirektor der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus »ein alarmierendes Niveau des Nichtstuns«. Es drängt sich daher die Frage auf, warum es so lange dauerte, bis man das pandemische Potential des neuen Coronavirus erkannt hatte. Das führt uns zu These 2.
Das pandemische Potential von SARS-CoV-2 war erkennbar
Entsprechend These 2 war schon früh deutlich geworden, dass SARS-CoV-2 durchaus das Potential hatte, eine Pandemie auszulösen. Übersehen wurde diese Tatsache insbesondere deshalb, weil Argumente in Umlauf waren, die auf falschen sachlichen Annahmen oder grundlegenden Denkfehlern beruhen.
Nach einem ersten Argument, das auch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vertreten wurde, ist SARS-CoV-2 mit den saisonalen Grippeviren vergleichbar. Niemand befürchte aber, dass die jährlich auftretende Grippewelle, die in der Saison 2017/18 immerhin 25 000 Todesopfer forderte, plötzlich in eine unkontrollierbare Pandemie umschlagen würde. SARS-CoV-2 werde daher in seiner Gefährlichkeit überschätzt.
Diese Position nahm auch der Publizist Gabor Steingart erstaunlich lange ein. In einem Blogpost vom 4. März 2020 diagnostizierte er, die Vernunft stehe im Moment unter Quarantäne. Er wies darauf hin, dass sich bis dato in Deutschland nur 196 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert hätten und noch niemand gestorben sei. Dagegen habe die saisonale Influenza bereits 161 Todesopfer gefordert. Auch im Straßenverkehr, so Steingart, würden über 3000 Menschen pro Jahr sterben. Folglich sei übermäßige Sorge unbegründet.
Dieser Gedankengang übersieht, dass sich SARS-CoV-2 von der saisonalen Grippe in wesentlichen Punkten unterscheidet: Anders als SARS-CoV-2 sind saisonale Grippeviren endemisch, sie treten also in einer bestimmten Region fortwährend und gehäuft auf. Es existieren zwar Ansteckungsketten von Person zu Person, doch führen diese nicht zu einem epidemischen Ausbruch, weil die Zahl der Infizierten saisonal mehr oder weniger konstant bleibt.
Technisch lässt sich dies durch das Verhältnis zweier epidemiologischer Kennzahlen erklären, nämlich durch das Verhältnis zwischen der Basisreproduktionszahl (R 0) und der Suszeptibilitätszahl (S). R 0ist die Anzahl der Personen, die eine infizierte Person im Durchschnitt in einer nicht-immunen Bevölkerung ansteckt, sollten keine Gegenmaßnahmen wie etwa »Physical Distancing« ergriffen werden. S ist der für die jeweilige Erkrankung anfällige Bevölkerungsanteil. Wenn das Produkt R 0× S bei einem Wert von 1 liegt, dann besteht ein endemisches Gleichgewicht. Wenn der R 0-Wert eines Krankheitserregers zum Beispiel 1,5 beträgt, aber nur zwei Drittel der Bevölkerung anfällig sind, weil ein Drittel aufgrund früherer Infektionen oder einer Impfung immun ist, dann ergibt sich folgende Rechnung:
R 0× S = 1,5 × 2/3 = 1.
Diese Konstellation begegnet uns bei saisonalen, endemischen Grippeviren.6
Bei epidemischen Viren wie dem SARS-CoV-2 sieht das ganz anders aus. Aufgrund seiner vergleichsweise hohen Kontagiosität (Fähigkeit zur Ansteckung) liegt der R 0-Wert von SARS-CoV-2 deutlich über 1, wahrscheinlich zwischen 2 und 2,5. Das RKI geht sogar von einem Wert zwischen 2,4 und 3,3 aus.7 Außerdem ist in diesem Fall vermutlich noch niemand gegen den Erreger immun.8 Damit ist S = 1.
Was bedeutet das? Gehen wir davon aus, dass R 0= 2. Das würde bedeuten, dass die erste mit SARS-CoV-2 infizierte Person in einer Bevölkerung jeweils zwei weitere ansteckt, die wiederum je zwei weitere anstecken usw. Dadurch ergibt sich ein explosionsartiges, exponentielles Wachstum, das aufgrund der höheren Suszeptibilität der Bevölkerung zudem einen deutlich größeren Bevölkerungsanteil erfasst, als saisonale Influenza-Erkrankungen dies können. Da sich diese Welle in allen Ländern ausbreitet, in die SARS-CoV-2 eingeschleppt wird, verursacht das Virus absehbar überall Epidemien und führt damit zu einer Pandemie. Saisonale Grippeviren tun das nicht.
Weil dieser Unterschied zwischen saisonaler Grippe und SARS-CoV-2 bekannt war, war auch das pandemische Potential des Virus ohne größere Schwierigkeiten erkennbar.
Nun könnte man einwenden, dass dasselbe Argument für SARS-CoV, also den Erreger des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms (SARS), gegolten hat. Die Verbreitung dieses Virus ließ sich 2003 aber erfolgreich eindämmen, nach weltweit 8000 Fällen und 800 Todesopfern.
Auch dieses Gegenargument übersieht grundlegende Unterschiede zwischen SARS-CoV und SARS-CoV-2: Zwar bestehen tatsächlich viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Erregern. So gehören beide zur Familie der Coronaviren, teilen etwa 86 % des Erbguts und werden vorrangig durch Tröpfcheninfektion übertragen. Das klinische Bild ist ebenfalls ähnlich: Beide Viren befallen die Atemwege und können schwere Krankheitsverläufe nach sich ziehen.
Gleichzeitig unterscheiden sich die beiden Erreger aber in mehrfacher Hinsicht. Die wichtigsten Unterschiede liegen in der Kontagiosität und in den Symptomen der verursachten Erkrankungen. So ist SARS-CoV-2 ansteckender als SARS-CoV. Zudem verläuft eine Infektion mit SARS-CoV-2 anders als eine Infektion mit SARS-CoV. Bei vielen Patienten führt sie nur zu milderen (oder sogar eventuell zu gar keinen) Symptomen, was es vergleichsweise schwerer macht, Ansteckungen früh zu erkennen und Ansteckungsketten durch geeignete Maßnahmen zu unterbrechen.
Diese Unterschiede waren früh bekannt, und wer sie zur Kenntnis nahm, musste erwarten, dass sich die Eindämmung von SARS-CoV-2 deutlich schwieriger gestalten würde als die Bekämpfung von SARS-CoV.
Das Schadenspotential von SARS-CoV-2 war erkennbar
Wer die Thesen 1 und 2 akzeptiert, wer also einräumt, dass Pandemien erwartbar sind und auch die Covid-19-Pandemie früh absehbar war, könnte dennoch die Berechtigung von These 3 bestreiten. Sie besagt, dass nicht nur das pandemische Potential von SARS-CoV-2, sondern auch sein Schadenspotential früh erkennbar war.
Читать дальше