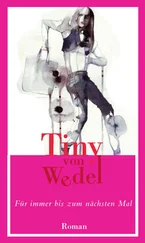Dafür lernen wir Carlos und Julio kennen, zwei reizende Parkwächter und echte Unikate. Carlos bewacht den Autoparkplatz sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag. Seine Schlafkammer liegt direkt über dem Büro der Parkplatzbetreiberin, nur hin und wieder hat er sonntags frei. Er ist praktisch immer da. Der Siebenundvierzigjährige freut sich, zwei Gringos kennenzulernen, und plaudert gerne mit uns. Ich komme manchmal tagsüber auf dem Weg zum Markt bei ihm vorbei und bleibe stehen, um mich mit ihm zu unterhalten. Mit der Zeit erfahre ich, dass Carlos hochgebildet und in Wirklichkeit für seinen Job völlig überqualifiziert ist. Er hat Kommunikationswissenschaften studiert und vier Jahre lang im französischen Kulturinstitut in Lima gearbeitet. Sein fast perfektes Französisch haut mich um. Ich schäme mich wahnsinnig dafür, dass ich ihm so etwas nie zugetraut hätte. Ich frage ihn also: »WAS machst du hier, Carlos?!« Und er erzählt mir von einer kaputten Ehe, von zwei Töchtern, die er selten sieht, von Reiseplänen und von Freiheit, die er früher vermisst hat. Doch wirklich frei ist Carlos jetzt auch nicht. Er verbringt seine Tage hauptsächlich mit Julio, einem kauzigen Rentner mit schlecht rasiertem Bart, Gehstock, runder Brille im Gesicht und schiefen Zähnen. Julio macht die Nachtschichten und bewacht die Autos auf der Straße, die in der Autogarage keinen Platz mehr bekommen haben. Wenn er fertig ist und Carlos mit seiner Schicht anfängt, frühstücken die beiden zusammen. Auch Julio hat eine Ex-Frau und wenig Kontakt zu seiner Familie. Er erzählt mir, dass er früher Pilot war und viel gereist ist, auch in Deutschland war er oft. Stolz präsentiert er ein paar Sätze auf Deutsch. Die beiden Herren fragen mich viel über Österreich, Carlos möchte unbedingt einmal nach Europa reisen. Er gibt mir auch viele Lesetipps, er kennt die großen lateinamerikanischen Autoren gut und schätzt die Poesie. Ich bin immer wieder beeindruckt von unseren Gesprächen, nachdem ich mich verabschiedet habe und nach Hause spaziere. Das ist es für mich wahrhaftig, was »ein Land und seine Leute kennenlernen« bedeutet. Über diese Begegnung vergesse ich fast den ärgerlichen Auslöser dafür – unsere hippe, alte Rostlaube. Täglich wächst unser Credo: »Nach all dem Aufwand müssen wir den Bus jetzt richtig ausnutzen und die Fahrten damit genießen!« Wenn jemand sagt, dass man etwas genießen MUSS, dann ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Wir setzen uns schlauerweise in den Kopf, die mindestens achtstündige Fahrt in die zweitgrößte Gebirgskette der Welt – die Autostrecke von Lima führt auf über 4000 Höhenmeter hinauf – mit dem Bus anzutreten. Zwei Tage lang laufe ich zwischen der Autowerkstatt und Carlos’ Parkgarage hin und her und versuche den Mechanikern Druck zu machen, damit der VW-Bus rechtzeitig zum Tag der geplanten Abfahrt für steile Bergstraßen umgerüstet ist. Sie haben wie gewohnt keine Eile und lassen sich ihre Arbeitszeit trotzdem gut bezahlen. Endlich, mit einem vollen Tag Verspätung, legen wir eines Sonntagmorgens los. Carlos steht extra um vier Uhr früh auf, um uns das Tor zu öffnen, als wir wegfahren, winkt er uns hinterher und ruft »Suerte!«, was wir tatsächlich gebrauchen können. Tom fährt, und wir sind entspannt: Die ersten drei Fahrtstunden führen uns nur an der Küste entlang, erst danach wird es ernst, wenn es hinauf in die Anden geht. Da sitzen wir also zu zweit in einem rostigen Bus, in dem locker zehn Personen Platz hätten, was ja an sich schon eine Perversität für uns deklarierte Ökos ist, und freuen uns an unserer Freiheit. Bevor wir von der Küste in die Berge abbiegen, machen wir halt in einem kleinen Fischerdorf, um eine Kleinigkeit zu essen. Wir parken unser Ungetüm direkt vor einem Café in einer sehr belebten Straße und gehen hinein. Von unserem Tisch aus können wir die Schnauze des Busses sogar sehen, nach weniger als dreißig Minuten verlassen wir das Café wieder. Ihr ahnt wohl schon, was jetzt kommt. Als wir zurückkehren, bemerke ich, dass der Kofferraum offen ist – und unsere Rucksäcke fehlen. Die Polizei, die praktischerweise direkt neben unserem Auto steht, gibt an, nichts gesehen zu haben. Aha. Die beiden jungen Polizisten erklären uns, dass sie hier zum persönlichen Schutz eines Zeugen stationiert sind. Dieser Ort wird mir immer sympathischer. Dann fällt ihnen ein, dass ihr Zeuge eine Überwachungskamera installiert hat, und verschwinden in seiner Wohnung. Kurz darauf kommen sie zurück und erzählen uns, was die Kameraaufnahme zeigt: Drei junge Typen haben binnen Sekunden mit einem Schraubenzieher unseren Kofferraum aufgebrochen und die Rucksäcke mitsamt unserer ganzen Bergsteigerausrüstung mitgenommen. Das Klischee vom reichen, weißen Mann im VW-Bus mit gutem, teurem Bergequipment im Kofferraum dürfte sich auch bis hierher herumgesprochen haben. Nach stundenlanger sinnloser Anzeigenerstattung in einem tristen Polizeikommissariat ohne Fensterscheiben, während der uns der Polizeikommandant noch stolz seine Sammlung konfiszierter Drogen und Schusswaffen vorführt, geben wir auf: Ohne eine warme Jacke oder Handschuhe müssen wir gar nicht erst in die Anden fahren. Und so kehren wir um, zurück nach Lima. Noch bevor wir die Stadtgrenze erreichen, haben wir entschieden: Dieses Auto wird uns keine Freude mehr machen, sondern immer nur noch mehr Ärger. Vierundzwanzig Stunden später steht es bereits wieder online zum Verkauf. Drei Wochen später haben sich immer noch kaum Interessenten gemeldet. Wir müssen zugeben: Wenn sich nicht ein anderes, ebenso illusioniertes Möchtegern-Hippie-Pärchen findet, dem wir den Bus aufschwatzen können, dann werden wir mit dieser Investition ziemlich draufzahlen. Anscheinend wissen die meisten inzwischen, dass Bustickets in Südamerika viel billiger und praktischer sind als ein eigenes Gefährt. Manchmal entdecken wir in den Straßen Limas noch einen bunt bemalten VW-Bus, oft mit argentinischem, chilenischem oder uns fremdem Autokennzeichen. Wenn wir einen Blick hineinwerfen können, dann tun wir das immer noch, aus Neugierde, doch der Neid ist uns längst vergangen. Vielmehr spekulieren wir darauf, zu erkennen, dass die Van-Besitzer ebenfalls mit ihrer Reiseart zu kämpfen haben. Manchmal ist der Innenraum zur Schlafkoje umgebaut, hin und wieder sehen wir richtige Werkstätten durchs Fenster: Künstler, die Schmuck, Dekoratives aus Naturmaterialien oder Kleidung herstellen, scheinen so unterwegs zu sein. Einmal sehen wir sogar eine fahrende Bibliothek. Die Aufschriften auf den Bustüren laden ein, das geplante Abenteuer auf Instagram oder Facebook mitzuverfolgen oder sogar mit Spenden zu unterstützen. Reisen wird immer mehr zum Projekt. Unser Projekt erklären wir endgültig für beendet, als sich endlich ein Käufer findet: Eine Marketingfirma will den Van kaufen und wir übergeben ihn frei von schlechtem Gewissen – diese Karre ist wahrlich geeignet, um als reines Image-Objekt für Bierverkostungen in Einkaufszentren herumzustehen. Meine Erleichterung ist unendlich groß, als ich gemeinsam mit Carlos dem jungen Burschen von der Marketingfirma hinterherwinke, der mit einigen Startschwierigkeiten den Van zur Ausfahrt des Parkplatzes manövriert. Ich grinse über beide Ohren, doch Carlos schaut mich ein wenig bedrückt an. »No te preocupes, Carlos«, lache ich, »continuaré visitándote aqui!«
Unser Reiseziel in den Anden verlieren wir trotz Diebstahlfiasko nicht aus den Augen. Für unseren zweiten Versuch nehmen wir aber doch lieber den öffentlichen Bus. Das ist tatsächlich bequemer, geht schneller und ist billiger. Was haben wir uns bloß dabei gedacht, selbst dorthin fahren zu wollen? Doch was geschehen ist, ist geschehen und wir wollen uns nicht mehr weiter darüber ärgern. So erreichen wir mit einer Woche Verspätung das peruanische Mekka der Bergsteiger. Die kleine Andenstadt ist auch am Ende der Hauptsaison erfüllt von durchtrainierten Gringos und Straßenkünstler-Hippies, die in löchrigen, bunten peruanischen Hosen oder mit großem Rucksack und klobigen Bergstiefeln unterwegs sind. Wir befinden uns hier am Ausgangsort für Bergtouren und Kletterausflüge bereits auf über 3000 Höhenmetern, und die meisten Touristengesichter, die uns begegnen, haben einen leicht verbrannten Teint. Wir steigen in einem Hostel ab, das als Geheimtipp gilt und gut versteckt in einer Hauseinfahrt hinter einem unbeschrifteten Tor liegt. Die Besitzerin des Hostels ist Mariella, sie verlangt nicht mehr als umgerechnet drei Euro pro Nacht von jedem Gast, was selbst für peruanische Verhältnisse extrem wenig ist. Das Haus ist immer voll. Weil viele Gäste für ein paar Tage in den Bergen unterwegs sind und dann wiederkommen, ist ihr eigenes kleines Zimmer zum Gepäckraum geworden, wo sie Nacht für Nacht einen großen Berg an Wertgegenständen bewacht. Bei ihr darf ungestraft gekifft und gefeiert werden. Mariella bleibt noch im größten Chaos völlig entspannt, obwohl sie mit diesem Hostel ganz bestimmt nicht reich geworden ist, dafür aber regelmäßig der Polizei Schmiergeld zahlen muss. Sie freut sich einfach, wenn die Gäste bei ihr eine gute Zeit verbringen, und das tun sie auch. Vor allem unzählige Franzosen, Israelis und Deutsche treffen wir hier an. Sie alle wollen nur eines: hoch hinaus, die Berge bezwingen, Touren unternehmen, die zu Hause niemals möglich wären. Hier im Hostel werden abends beim Bier Tipps ausgetauscht, Equipment untereinander verliehen und hin und wieder auch gemeinsame Ausflüge geplant. Auch wir starten schließlich eine dreitägige Tour zusammen mit einer Österreicherin, einem Australier und einem Deutschen, Steffen.
Читать дальше