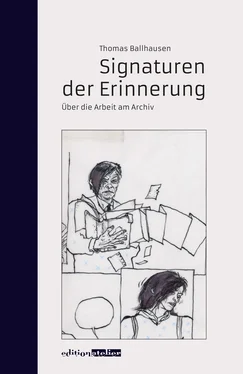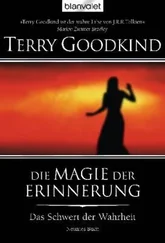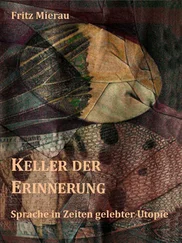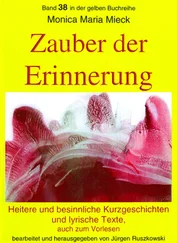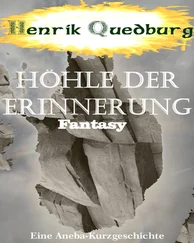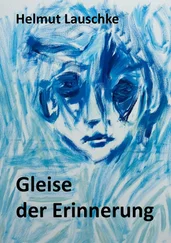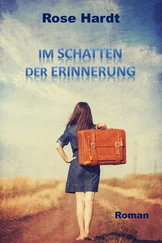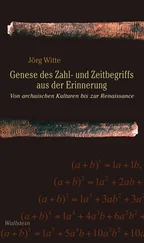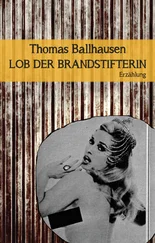Thomas Ballhausen - Signaturen der Erinnerung
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Ballhausen - Signaturen der Erinnerung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Signaturen der Erinnerung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Signaturen der Erinnerung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Signaturen der Erinnerung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Signaturen der Erinnerung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Signaturen der Erinnerung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Der Kulturphilosoph Roberto Calasso beschreibt in seinem Buch Der Untergang von Kasch das Verhältnis zwischen Natur und Kultur über die Notwendigkeit des Auswählens und Bewahrens als Akt der Kulturstiftung:
„Der Überschuß ist das Mehr der Natur im Verhältnis zur Kultur. Er ist jener Teil der Natur, den die Kultur zu verspielen, zu verbrauchen, zu zerstören und zu weihen genötigt ist. Im Umgang mit diesem Überschuß zeichnet jede Kultur ein Bild der eigenen Physiognomie. Das Gesetz neigt zur Monotonie, seine Variationen sind kläglich, wenn man sie mit der üppigen Vielfalt der Formen vergleicht. Und die Formen bilden den Fächer der Opferspielmöglichkeiten. Das Opfer ist unserer Physiologie eingeschrieben: Jede Ordnung – ob biologischer oder sozialer Art – beruht auf einer Aussonderung, auf einem gewissen Quantum verbrannter Energie, denn die Ordnung muß kleiner sein als das Ordnende. Die einzige Ordnung ohne sichtbare Aussonderung wäre eine, die dem pflanzlichen Stoffwechsel gliche. Das wäre eine Kultur, die Bestand hätte, ohne sich auf einen Unterschied zu gründen, also ohne sich überhaupt auf etwas zu gründen: eine Kultur, die vom Rascheln eines Baumes nicht zu unterscheiden wäre“ (Calasso, 2002, 180).
Besagte Tätigkeit lässt sich aber auch als Archivstiftung lesen, in der die Natürlichkeit des Materials (das Ordnende bzw. das zu Ordnende) und das Archiv als System (die Ordnung) miteinander verschaltet werden. In der zitierten Passage sind das Verspielen, das Verbrauchen und das Zerstören besonders auffällige Schlagworte; Calasso denkt an dieser Stelle seines bemerkenswerten Werkes von der Position des Opfers und der Opferung her. Dieser Prozess der (Auf-)Opferung, der immer häufiger auch eher wirtschaftlich denn kulturell gedacht wird, beeinflusst mit seiner Beschleunigung die „Dauer des Erbes“ (Derrida, 2005, 41) durchaus auch ungünstig. Wesentlicher und auch positiver für vorliegende Ausführungen ist das von ihm ebenfalls beschworene Weihen, also eine im Sinne Heideggers sinn- und kunststiftende Funktion des Bewahrens, die im Wechselverhältnis zur Beschaffenheit des zu bewahrenden Gutes steht: Auch das Material gibt die Konditionen des Bewahrens vor (Heidegger, 1963, 56–58).
1.3.2 Erinnerungsdiskurs und Archivsystem
Erinnerungsdiskurs und Archivsystem – das sind die beiden Gesichter eines janusköpfigen Kindes der Moderne, die uns im besten und vielfältigsten Sinne des Wortes als Depots unterschiedlicher, doch miteinander verknüpfter Wirkungsweisen entgegentreten. Basierend auf antiken Quellen hat die Auseinandersetzung mit Gedächtnis und Erinnerung zwar eine lange Tradition, doch wesentliche Veränderungen kamen hier – ebenso wie die aus ihrem wirtschaftlichen oder juristischen Primärumfeld herausgelösten Archive – erst im frühen 20. Jahrhundert. Bedingt durch zeitgeschichtliche Zäsuren und die Entwicklungen auf dem Feld der Technik sind diese beiden Bereiche wieder verstärkt in den Blickpunkt unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen gerückt – geprägt nicht nur von konstruktiven Auseinandersetzungen, sondern auch von oft schwierigen, doch dringend notwendigen Diskussionen um wissenschaftsgeschichtliche Aspekte der wesentlich weniger erfreulichen Art: Vergessen, Verdrängung, Verzerrung.
Der Wunsch nach einer Verlebendigung des Bewahrten und einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist in unserer (Diskurs-)Gegenwart, die auf eine angenommene Zukunft hinarbeitet, durchaus unterstützenswert:
„Der Wunsch von Individuen oder Gemeinschaften, sich eine andere Vergangenheit zu geben oder Teile der eigenen Vergangenheit neu zu entdecken und zu bewerten, macht aber auch auf eine andere Möglichkeit der Archive im Umgang mit Vergangenheit aufmerksam, nämlich jene, die Teile des kollektiven Gedächtnisses, über die sie verfügen, neu anzuordnen und in einen neuen Sinnzusammenhang einzufügen“ (Auer, 2000, 62).
Diese Arbeitsweise war besonders für Aby Warburg, der neben Maurice Halbwachs als einer der wichtigsten Vertreter des uns heute vertrauten Erinnerungsdiskurses gelten kann, von Bedeutung. Während der Soziologe Halbwachs in seinen Schriften zum Erinnerungsdiskurs die soziale Bedingtheit des kollektiven Gedächtnisses in das Zentrum seiner Überlegungen stellte, vertrat der Kunsthistoriker Warburg die Auffassung einer auf Symbolen basierten Kultur, deren daran angeschlossenes kollektives Gedächtnis je nach Zeit und Ort aktualisiert und verändert werden würde. In seiner induktiven, vom Material diktierten Herangehensweise kann Warburgs Ansatz als postmodernes Vorzeichen eines – im homonymen Sinne – überaus modernen Vertreters gelten, auf den auch noch neueste erinnerungsspezifische Theorien rekurrieren. Besonders deutlich wird dabei die Methode einer fächerübergreifenden Herangehensweise, die sowohl Halbwachs als auch Warburgs Methoden kennzeichnet und auch das Verhältnis von Erinnerungsdiskurs und Archivsystem ganz deutlich mitbestimmt:
„Gedächtnis und Depot verweisen aufeinander, so wie Erinnerung und Exponieren aufeinander verweisen. Das aber heißt, daß Akte des aktiven Erinnerns in Form des Exponierens und des Aktivierens von gespeichertem und magaziniertem Material eines aktuellen Rahmens […] bedürfen. Mit der Rahmung erfolgt eine Redimensionierung von Relikten der Vergangenheit aus der Sicht und der Interessenskonstellation einer jeweiligen Gegenwart: Erst das Exponieren macht aus dem Zeugs den Zeugen, erst in der Auf- und Gegenüberstellung wird der Zeuge aussagefähig, erst im Kreuzverhör der Ex-, Juxta- und Kontraposition wird der Zeuge zur Auskunft veranlasst“ (Korff, 2000, 45).
Das Archiv steht für eine geordnete Sammlung, die, abseits ihrer stark auf den wirtschaftlichen Bereich fokussierten Ausrichtung, in den letzten Jahrzehnten immer häufiger in konstruktiver Verbindung zu den Bereichen des Museums und der Bibliothek gedacht und konzipiert wird. Dies liegt neben der Praktikabilität der Verknüpfung wohl zu einem Gutteil auch daran, dass diese Institutionsformen zumeist ebenfalls interne Archive ausbildeten, um heterogene Teilbestände adäquat aufarbeiten und verwalten zu können. Abseits der klassischen Sammlungsinhalte, wie etwa dem Medium Buch (für die Bibliothek) oder dem mehr oder minder singulären Objekt (für das Museum), fanden etwa Nachlässe oder nicht-publiziertes Material ihren Weg in diese Institutionen. Die Herausforderung der Datenerfassung, der Bewahrung und sachgerechten Aufarbeitung verlangte und verlangt nach einem archivalischen Zugang innerhalb erwähnter sammlungsspezifischer Strukturen. Die Bewahrung der Bestände kann dabei als die wohl dringlichste Aufgabe verstanden werden:
„Ungeachtet aller Zufälle und Wechselfälle der Überlieferung bleibt das Bewahren natürlich konstitutives Element und wesentlichste Funktion der Archive. Darin besteht ihr wichtigster Beitrag zur Bewahrung von Gedächtnis, daß sie Vergangenes erhalten und Vergessenes neu ans Licht bringen“ (Auer, 2000, 61).
Dieser wissenschaftlich unterfütterte Vorgang der Rückgewinnung des Vergessenen, Vergangenen und auch Verdrängten kann nur im Sinne einer Balance zwischen Bewahren und Zugänglichmachen der Bestände – so ihre Beschaffenheit dies zulässt – gedacht und gelebt werden.
Das Archiv – das gleichermaßen System der Ordnung und eigentliche Sammlung ist, die durch ein differenzschaffendes Scharnierelement administrativer, submedialer Prozesse verbunden sind – kann auf diesem Weg als Ort der intellektuellen Wertschöpfung begriffen werden, der durch seine heterogenen Bestände vor-geprägt ist. Die unterschiedlichsten Arten des Bestandes sind dabei eben nicht nur wesentliches Kennzeichen, sondern vielmehr auch eine positiv wirksame Rahmenbedingung für den Umgang mit dem jeweiligen Material und Vorgabe gewisser Grundlinien diskursiver Arbeiten und Herangehensweisen. So kann abseits von fälschlich unterstelltem Selbstzweck über eine andauernde Neubewertung nicht nur ein umfassenderes, besseres Verständnis der eigenen Disziplin und neuerer Entwicklungen, sondern auch ein kritisches Analyseinstrumentarium umfassenderer sozialer Prozesse gewonnen werden. Die konsequente Befragung der gegebenen Sammlungsbestände – was also etwa noch als Ausstellungsexponat tauglich ist oder aber eben schon Teil einer disziplinhistorischen Auseinandersetzung gilt – kann eben nicht im engen Verständnis einer als allumfassend missverstandenen Hermeneutik der endgültigen und immerwährenden Ergebnisse stattfinden. Vielmehr verlangt eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Erinnerung und Archiv nach einer – im poststrukturalistischen Sinne – Kette miteinander verknüpfter Auslegungen, die auch die Geschichte des eigenen Arbeitsfeldes befruchten und vorantreiben. Trotz der mitunter kritisch zu betrachtenden Ausrichtung dieser interpretativen Verfahrensweise, ist diese doch die geeignetste, um die Veränderung des Stellenwertes des erfassten Materials in Bezug zu einer – im Sinne von Hans Robert Jauß – in narrativen Formen organisierten (Disziplin-)Geschichtsschreibung und hinsichtlich aktueller Fragestellungen aufzuzeigen: „Der wissenschaftliche Wert eines Untersuchungsgegenstandes erschließt sich erst in Bezug auf jenes Fragenfeld, auf das zu antworten es erlaubt und damit die Grenzen seiner Aussagekräftigkeit bestimmt“ (Ernst, 2002, 119). Zu berücksichtigen bleibt dahingehend auch die disziplininterne Bedeutungszuschreibung im Rahmen einer zweifachen Bewegung: Die erste dieser Bewegungen ist die Herausentwicklung des jeweiligen Artefakts aus einer der Entropie verhafteten Phase der Unordnung, des Chaos’, vielleicht sogar des Mülls (Thompson, 2003) in einen Zustand der Aufwertung. Die zweite, daran wohl zumeist anschließende Bewegung ist die einer – auch mnemotechnisch relevanten (Yates, 1990, 336ff.) – Zirkulation von Semantisierungsleistungen im Rahmen der Auseinandersetzung mit Sammlungsbeständen und Einzelobjekten, einem Diskurs im Sinne eines Oszillierens zwischen zwei Spannungspunkten: „Archivalien sind also keine Frage von Vergangenheit, sondern einer Logistik, deren Koordination quer zur Beobachterdifferenz von Gegenwart und Vergangenheit liegt – eine kybernetische Funktion von Latenz und Aktualisierung“ (Ernst, 2002, 120f.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Signaturen der Erinnerung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Signaturen der Erinnerung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Signaturen der Erinnerung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.