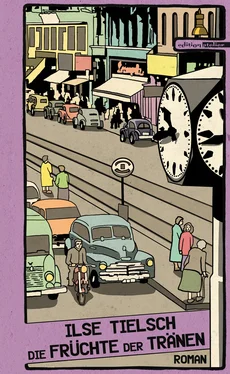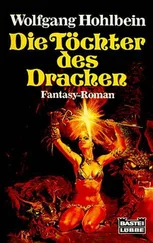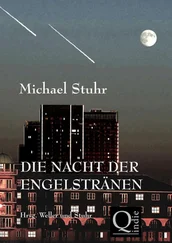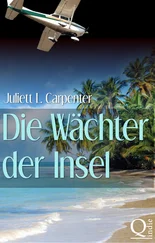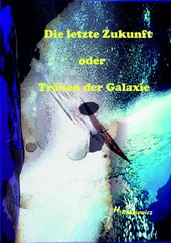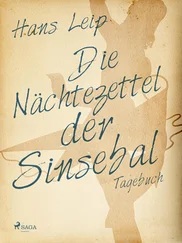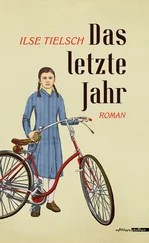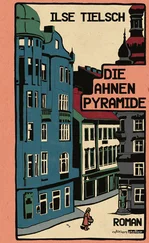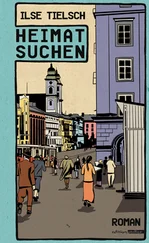1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 Wenn man endlich erkannt haben wird, daß das falsch gewesen ist, dann werden wir längst nicht mehr hier sein. Aber, sagte die kleine Großmutter Anna, in der Heimat wird es für uns auch sehr viel Arbeit geben, wenn wir zurückkommen. In der Heimat wird auch viel wieder aufzubauen sein.
Die Sehnsucht der Alten war groß, und die Heimat war weit entfernt, nur wenige, die aus der Umgebung von B. stammten, hatte es in die Föhrenwälder rund um Erlangen verschlagen. Sie legten an Sonntagen oft weite Fußwege zurück, um einander beim Kirchgang zu treffen. Nach dem Gottesdienst standen sie dann auf der Straße beisammen und besprachen die politische Lage. Manchmal hatte auch der eine oder der andere einen Brief erhalten, in welchem Wissenswertes aus anderen Landesteilen oder über in anderen Gegenden Deutschlands lebende Bekannte mitgeteilt wurde, ein Kind war geboren worden, ein Verschollener hatte sich über das Rote Kreuz gemeldet, ein Mädchen aus einer heimatvertriebenen Familie hatte einen einheimischen Mann geheiratet, dies allerdings kam selten vor, noch seltener gab man einem der besitzlosen Vertriebenen ein einheimisches Mädchen zur Frau. Erst 1955 stellte man anhand von Statistiken fest, daß die Neigung der Vertriebenen, untereinander zu heiraten, nachgelassen habe, daß die Verschwägerung zunehme, daß DIE ZEIT MITHELFE, DEN STROM DES ZUSAMMENLEBENS ZU VERBREITERN. Man zog zu diesem Zeitpunkt die Folgerung, daß das soziologische Aufgehen der Vertriebenen in die größere Gruppe des einheimischen Gesamtvolkes als allmählicher Prozeß nicht mehr aufzuhalten sei.
Wenn ich an jene Zeit zurückdenke, sagt Heidi, wenn ich mich daran erinnere, wie der Großvater bei jedem Wetter den weiten Weg nach Röttenbach zur Kirche gegangen ist, um die Leute, die er gekannt hat, zu treffen und mit ihnen zu sprechen, wenn ich mich daran erinnere, wie sie bei jedem Wetter vor der Kirche beisammengestanden sind, auch wenn es geregnet hat, auch im Winter, wenn es sehr kalt gewesen ist, dann verstehe ich die Fremdarbeiter, die sich auf den Bahnhöfen treffen. Weil sie miteinander in ihrer Sprache reden wollen, weil sie Sehnsucht nach ihren Heimatländern haben. Gerade wir Heimatvertriebenen, sagt Heidi, die sich heute als Nürnbergerin fühlt, gerade wir, die wir unter der Fremdheit gelitten haben, als wir hierherkamen, müßten diese Leute besser als andere verstehen.
Ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, sagte Hedwig, als ich in ihrem Wohnzimmer in Nürnberg saß, aber was sollte diese Frau für ein Interesse daran gehabt haben, mit dir in Verbindung zu treten?
Ich hatte ihr von dem Telefongespräch in Waldkraiburg und von der ablehnenden Reaktion der Frau aus dem Adlergebirge erzählt.
Wenn es sich um eine nahe Verwandtschaft gehandelt hätte, sagte Hedwig, aber nur, weil diese Frau so heißt wie du?
Wahrscheinlich, sagte sie, ist sie mißtrauisch gewesen und hat überhaupt nicht verstanden, was du von ihr willst.
Ich weiß selbst nicht, was ich von ihr gewollt habe, sagte ich.
Alles, was du über die Landschaft und über die Leute aus dem Adlergebirge wissen willst, kannst du wahrscheinlich aus Büchern erfahren, sagte Hedwig. Man ruft keine wildfremden Leute an, wenn man keine guten Gründe dafür hat.
Da hast du wahrscheinlich recht, sagte ich.
Spurensuche, die Sucht, Altes und Gegenwärtiges zu einem Ganzen zu fügen, wie sollte ich das meiner Tante, wie sollte ich es mir selbst erklären?
Im Museum der Adlergebirgler, in Waldkraiburg, hatte ich alte Kalender gesehen, in einem dieser Kalender ein Kinderlied, ich hatte es wieder und wieder gelesen, der Leiter des Museums, der die Sammlung zusammengetragen hat, hat mir den Kalender geschenkt. Die Melodie, zu der es gesungen worden ist, kennt heute niemand mehr.
Schloof, Kendla, schloof,
dr Voatr hitt de Schoof,
schloof Kendla, sisse,
doas Schoof hoot weiße Fisse,
schloof ock, Kendla, lange,
dr Tuud hockt off dr Stange,
a hood a lemta Jackla oa
on schmeißt gebacken Bärna roa.
Hat dieses Liedchen, frage ich mich, das in einer Mundart abgedruckt worden ist, die niemand von den Jungen heute noch wirklich sprechen kann, Anna Josefa, die Großmutter meines Großvaters väterlicherseits, ihren zehn Kindern als Schlaflied vorgesungen? Hat ihr Sohn Josef es seinen eigenen Kindern aus dem Dorf Tschenkowitz nach Schmole mitgebracht, wo er Färber und Leinendrucker gewesen ist? Der Tod hockt auf der Stange und hat ein Jäcklein aus Leinen an, das in der alten Heimat gesponnen und gewebt worden ist, manche von denen, die heute auf dem Waldfriedhof liegen, sind noch in diesem Leinen begraben worden. Die Jungen aber kaufen ihre Hemden in bayrischen Geschäften, sie wissen nicht mehr, wie der Flachs auf den kargen Äckern ihrer Großeltern gediehen ist, wie er sich gegen den Spätsommer zu goldbraun färbte, wie die Körner der runden Samenkapseln schmeckten, wenn man sie aus der Kinderhand leckte. Aber auch meine Kinder wissen das ja nicht mehr.
Fünfzig Adlergebirgler liegen schon auf dem Waldfriedhof, früher hat man die Herkunftsorte auf die Grabsteine geschrieben, die Jungen tun das nicht mehr.
Ich, Anna, Urenkelin Josefs, der Färber in Schmole gewesen ist und ein Sohn Johann Wenzels aus Tschenkowitz war, versuche mir zu erklären, warum mich das mit Trauer erfüllt.
Heute interessiert sich niemand mehr für den anderen, sagte Hedwig, heute leben die Leute alle für sich, sie schließen sich ab, sie wohnen miteinander Tür an Tür und wollen doch nichts voneinander wissen. Früher ist das anders gewesen. Früher hat einer den anderen gebraucht, da war einer auf den anderen angewiesen. Es hat nicht so viele Einsame gegeben wie heute, weil einfach zu wenig Platz war, weil die Leute aneinander-gedrängt leben mußten, weil diese entsetzliche Wohnungsnot war.
Die Not überhaupt, sagte Hedwig, sie hat dazu beigetragen, daß die Menschen nicht so einsam wie heute gewesen sind. Ich meine die Zeit nach dem Krieg, sagte Hedwig. Das hat länger gedauert, als man es heute wahrhaben will, hier bei uns jedenfalls hat es sehr lang gedauert. Bis es erst einmal so weit gewesen ist, daß man von einem Dorf, in das man eingewiesen worden ist, in eine größere Stadt ziehen durfte. Bis man die Zuzugsgenehmigung bekommen hat. Und wenn man sie dann endlich hatte, wenn man sich einen Raum suchen durfte, in den man einziehen konnte, bis man dann einen solchen Raum überhaupt gefunden hat.
Uns ist das erst neunundfünfzig gelungen.
(Neunundfünfzig waren Großmutter Anna und Großvater Josef schon tot, in fremder Erde begraben, ohne die Heimat wiedergesehen zu haben.)
Der Mann, der uns damals zwei Zimmer in seiner Nürnberger Wohnung vermietet hat, ist freilich sehr einsam gewesen, sagte Hedwig. Sie erzählte mir die Geschichte von Karl Kodnik, der überallhin, wo es ihm möglich war, seinen Namen schrieb.
Auf jedes Ei, das er gekocht hat, sagte Hedwig, schrieb er: gekocht am soundsovielten, dann das Monogramm, K. K., Karl Kodnik. Neben den Lichtschalter schrieb er mit Tintenblei: nach rechts drehen. Karl Kodnik. Auf den Geschirrschrank schrieb er: Geschirr. Karl Kodnik. Wenn er ausging, legte er einen Zettel auf den Küchentisch: bin ausgegangen, Karl Kodnik. Überall schrieb er seinen Namen an, weil ihn sonst niemand geschrieben hat, sagte Hedwig, weil ihn auch niemand ausgesprochen hat, weil ihn niemand bei seinem Namen gerufen hat. Er hat keine Kinder gehabt, keine Verwandten oder Bekannten, er hat überhaupt niemals Post bekommen. Er hat mich oft mit allen möglichen Ausreden in der Küche zurückgehalten, nur um mit mir, der Flüchtlingsfrau, sprechen zu können. Er war schon sehr alt, aber das war nicht der Grund, er hat uns auch später noch, als wir ans andere Ende von Nürnberg gezogen sind, oft besucht, auch dann noch, als er nur noch auf Krücken gehen konnte.
Читать дальше