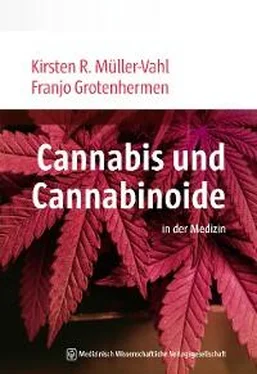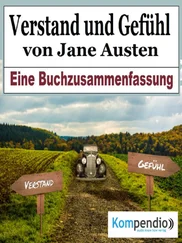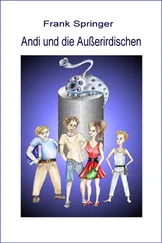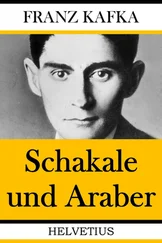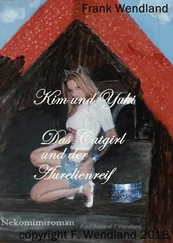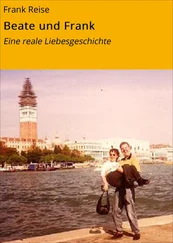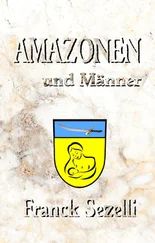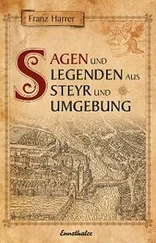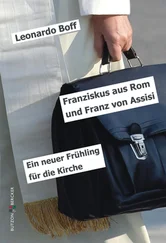1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen vermehrt chemisch orientierte Arbeiten über Cannabis. Man war bestrebt, das Geheimnis des „aktiven Prinzips“ dieser Pflanze zu lüften. Im Weiteren war das Standardisieren der Cannabispräparate ein großes Thema. Da man die Medikamente nicht genau auf einen bestimmten (noch nicht bekannten) Wirkstoff einstellten konnte, beklagten sich immer wieder Ärzte mit deren unzuverlässigen Wirksamkeit. Ein ebenfalls oft diskutiertes Thema war die Wirksamkeit von einheimischem Hanf. Überhaupt begann man nach dem ersten Weltkrieg Cannabis sativa wieder vermehrt zu berücksichtigen, weil indischer Hanf in Europa praktisch nicht mehr erhältlich war.
Nachdem die Cannabispräparate um die Jahrhundertwende noch rege benutzt wurden, verschwanden sie gegen Mitte des 20. Jahrhunderts vollständig. Dies waren die Gründe:
2.9.1 Medizinisch-pharmazeutischer Fortschritt
Für alle Hauptanwendungsgebiete der Cannabispräparate wurden noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts neue spezifische Arzneimittel eingeführt. Zur Behandlung der Infektionskrankheiten (Cholera, Tetanus, etc.) wurden Impfstoffe entwickelt, die nicht nur wie Cannabis die Symptomatik bekämpften, sondern sogar Schutz vor Infektionen boten. Andere bakterielle Erkrankungen wie die Gonorrhoe, die häufig mit Cannabis therapiert wurden, konnten etwas später durch das Aufkommen der Chemotherapeutika (bereits 1910 wurde das von Paul Ehrlich entdeckte Salvarsan in die Therapie eingeführt) therapiert werden. Auch als Schlaf- und Beruhigungsmittel bekam Haschisch Konkurrenz in Form chemischer Substanzen wie Chloralhydrat, Paraldehyd, Sulfonal und insbesondere der populären Barbiturate. Anders als die Vielzahl von Opiatmedikamenten wurden die Cannabispräparate auch als Analgetika bald von chemischen Mitteln verdrängt. Große Bedeutung erlangten schon kurz nach der Einführung das Antipyrin und das Aspirin.
2.9.2 Pharmazeutische Instabilität
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die unterschiedliche Wirksamkeit der Cannabispräparate auffiel. Verschiedenste Faktoren wie Provenienz, Alter, Lagerung und Galenik der Droge waren dafür verantwortlich, dass das Arzneimittel hochwirksam war oder unwirksam blieb. Anders als bei Alkaloid-Drogen wie dem Opium gelang die Isolierung des Tetrahydrocannabinols (THC) in reiner Form erst 1964, damit verbunden gab es zuvor Standardisierungsprobleme.
2.9.3 Wirtschaftliche Aspekte
Durch Einschränkungen in den Produktionsländern (vor allem Indien) und bedingt durch den ersten, dann aber auch noch am Rande durch den zweiten Weltkrieg, wurde es immer schwieriger, hochwertigen indischen Hanf nach Europa zu importieren. Auch für die Droge Cannabis galt das Gesetz von Angebot und Nachfrage, sodass die Preise sowohl der Rohprodukte als auch der Präparate massiv stiegen.
2.9.4 Rechtliche Einschränkungen
Durch die immer restriktiveren länderspezifischen und internationalen Gesetzgebungen wurde die Verwendung der Cannabismedikamente immer stärker eingeschränkt. Früher oder später wurden sämtliche Haschischpräparate der Betäubungsmittelpflicht unterstellt, was deren Anwendung in der Praxis massiv erschwerte, bis schlussendlich ein generelles Verbot die Verwendung verunmöglichte.
Nachdem Cannabis allmählich der Betäubungsmittelpflicht unterstellt wurde, kam 1961 das eigentliche Ende der medizinischen Karriere von Cannabis. Im Jahr 1958 war die medizinische Verwendung von Cannabis weltweit noch in 26 Ländern der UNO gestattet. Das sogenannte Einheits-Übereinkommen (Convention on Narcotic Drugs) führte nun de facto zu einem kompletten Verbot von Cannabis. Dies galt auch für die medizinische Anwendung, mit Ausnahme der wissenschaftlichen Forschung. Diese Ausnahmeregelung sollte sich noch als sehr wertvoll erweisen, denn so konnte weiterhin mehr oder weniger intensiv mit Cannabis geforscht werden. Bereits 3 Jahre nach Unterzeichnung des Abkommens gelang es den israelischen Wissenschaftlern Yechiel Gaoni und Raphael Mechoulam die chemische Struktur des Hauptcannabinoids, das THC, aufzuklären. Bereits 1 Jahre vorher war ebenfalls R. Mechoulam bereits dasselbe mit Cannabidiol (CBD) gelungen.
Ein weiterer Meilenstein in der Cannabisforschung folgte zu Beginn der 1990er-Jahre: die Entdeckung des körpereigenen Endocannabinoid-Systems. Das Auffinden der Cannabinoidrezeptoren führte zu einer explosionsartigen Intensivierung der Forschung. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse haben verschiedenste Länder Anstrengungen unternommen, Cannabispräparate oder Cannabinoide (THC bzw. Dronabinol, CBD, Nabilon, Nabiximol) verkehrsfähig zu machen, wenngleich dies je nach Land sehr unterschiedlich gehandhabt wird. In den letzten Jahren war es vor allem das Cannabisextrakt enthaltende Fertigarzneimittel Nabiximols (Sativex ®), das sich, nebst den Individualrezepturen (v.a. Dronabinol), etablieren konnte. Weltweit ist eine starke Tendenz zu erkennen, dass der Zugang für die medizinische Verwendung von Cannabis liberalisiert wird, so auch in Deutschland, wo seit 2017 das Verschreiben von THC-haltigen Hanfblüten möglich ist. Grosse Hoffnungen werden zudem in das medizinische Potenzial des nicht psychoaktiven CBD gesetzt, insbesondere zur Behandlung von Epilepsie. Ein neuerlicher Schritt in diese Richtung war die Zulassung des CBD-haltigen Medikamentes Epidiolex ®zur Behandlung schwerer Epilepsieformen durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA im Juni 2018.

Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Renaissance der Arzneipflanze Cannabis nicht mehr aufzuhalten ist. Ob Hanf die großen Erwartungen erfüllen kann, wird die Zukunft zeigen. Bereits heute ist Cannabis für viele Patienten ein unverzichtbares Medikament geworden.
Behr HG (1982) Von Hanf ist die Rede, Kultur und Politik einer Droge, Sphinx Verlag Basel.
Beron B (1852) Über den Starrkrampf und den indischen Hanf, Med. diss., Würzburg.
Brunner TF (1973) Marijuana in ancient Greece and Rome? The literary evidence, Bull hist med 47, 344–355.
De Courtive E (1848) Haschish, Etude historique, chimique et physiologique, Thèse pharm. Paris.
Dioskurides (1902) Arzneimittellehre in fünf Büchern. Übersetzt von J. Berendes, Nachdruck der Ausgabe von 1902, Enke Verlag, Wiesbaden.
Dreyfus R (1973) Zur Geschichte der Gefährlichkeit des Haschischs, Med diss., Bern.
Gelpke R (1975) Drogen und Seelenerweiterung, Kinder Verlag München.
Gmelin JF (1777) Allgemeine Geschichte der Pflanzengifte, Raspe, Nürnberg.
Haenel TA (1970) Kulturgeschichte und heutige Problematik des Haschisch. Med. Diss., Basel.
Homerus (1938) Odysee. Verdeutscht von T. von Scheffer, neu gestaltete Ausgabe, Dietrich, Leipzig.
Leonhardt RW (1970) Haschisch-Report, Dokumente und Fakten zur Beurteilung eines sogenannten Rauschgiftes, Piper-Verlag, München.
Manniche L (1989) An ancient Egyptian Herbal, Texas Press London.
Mechoulam R (1993) Early medical use of cannabis. Nature 363, 215.
Moller KO (1951) Rauschgifte und Genussmittel, B. Schwabe Verlag Basel.
Nees v. Esenbeck TFL, Ebermaier CH (1830) Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik, Erster Theil, Arnz und Comp, Düsseldorf.
O'Shaugnessy WB (1838–40) On the preparations of the Indian hemp, or Gunjah, Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal (1838–40), 421–461. Reprint in: Mikuriya T.H (1973) ed. Marijuana: Medical papers 1838–1972, Medi-Comp Press Oakland.
Читать дальше